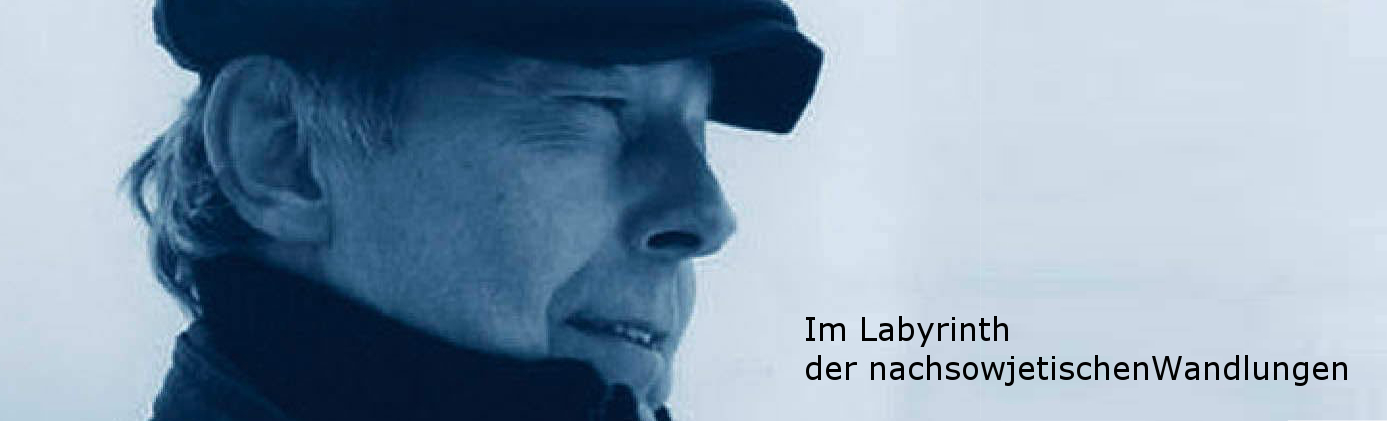1991 betrat Boris Jelzin die politische Bühne Rußlands. Neben Reichtum für alle versprach er auch Bildung für alle.
1992 erließ seine Regierung das „Gesetz über die Bildung“. 1993 wurde es durch die neue Verfassung festgeschrieben. Danach gilt die Bildungsreform als eine der wichtigsten nationalen Aufgaben. 10% des Volksaufkommens sollen dafür eingesetzt werden. Die Schulausbildung, ebenso wie der Besuch der Hochschulen soll weiterhin kostenlos sein und vom Staat getragen und gegebenenfalls mit Stipendien gefördert werden. Das aus Sowjetzeiten stammende staatliche Bildungsmonopol wird aber zugunsten einer weitgehenden Dezentralisierung und Diversifizierung abgelöst. Ein „einheitlicher Bildungsraum“ der russischen Föderation soll durch allgemein verbindliche „Bildungsstandards“ gewährleistet werden. Im übrigen haben die Regionen und Kommunen freie Hand, ihre Programme selbst zu gestalten. Neue Schultypen wie Gymnasien, Lyzeen und die Möglichkeit, private Schulen zu eröffnen, sollen das Angebot differenzieren. „Vielfalt in der Einheit“ lautet die von den Reformern ausgegebene Linie, „Abbau der Überqualifikation“ und „Effektivierung“ fordert die dahinterstehende Empfehlung des „Internationalen Währungsfonds“.
Unser Autor untersucht, was ein halbes Schülerleben später daraus geworden ist:
O-Ton 1, Schule in Ordinsk, Tür, Stimmen, Treppe 0,53
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, verblenden
Wir betreten die Schule Nr. 2 des Bezirkszentrums Ordinsk. Mit seinen 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern bildet Ordinsk den amtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt für ca. 30.000 Menschen, die in einem Gebiet von der Größe Schlesig Holsteins leben. Von der nächst größeren Stadt, Nowosibirsk, ist Ordinsk gut 100 Kilometer entfernt.
Die Schule ist eine von vieren des Ortes. Als sog. Mittelschule mit Unter-, Mittel- und Oberstufe entspricht sie dem heute üblichen durchschnittlichen Schultyp.
Freundlich gibt die Direktorin, Frau Vera Bjedkowa, Antwort auf alle Fragen. Schnell kommt sie auf ihr Hauptproblem:
O-Ton 2: Direktorin 0,20
„Problemi finanzirowannij…
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Das Problem der Finanzierung ist das Schlimmste: Die Schule hat sehr viele Schüler. Die Klassenräume reichen nicht. Die Schule ist nicht für so viel Lernende ausgelegt. Wir haben 700 Schüler, aber nur 13 Klassen. Darum müssen wir in zwei Schichten arbeiten. Das ist ein sehr großes Problem.“
…otschen bolschaja Problema“
Erzähler: In einer der Klassen, durch die man mich führt, konkretisiert eine Lehrerin:
O-Ton 3: Lehrerin in der Klasse 0,43
Kinder, Lehrerin: „Nu Trudnosti u nas…
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf am Ende des Erzählers hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Die Schwierigkeit besteht darin, daß wir nicht immer genug Material haben, um den Unterricht durchzuführen, also Kreide,, Filme, Karten usw. Rein äußerlich ist alles normal: Die Schule ist warm, hell, gemütlich. Aber die techniche Ausrüstung müßte besser sein.“
Erzähler: Probleme gibt es auch mit dem Lehrstoff. Für neue Schulbücher reicht es nicht. Zwar haben die Lehrer heute das Recht, die alten Texte selbst zu interpretieren, wenn keine neuen Bücher zur Verfügung stehen. Ein neugebildeter pädagogischer Rat aus Vertretern der vier Schulen und des örtlichen „Hauses für Kultur“, dem früheren Pionierklub, soll dabei helfen. Der aber ist selbst ziemlich hilflos.
Am Meisten Sorge macht die Lehrerin sich um die Veränderung der Kinder: Die Erstklässler kommen noch gern in die Schule, erzählt sie. Nach zwei, drei Jahren, endgültig aber in der 6. und 7. Klasse bleiben sie weg. Viele der Dreizehn- bis Vierzehnjährigen können nur noch mit disziplinarischen Mitteln in der Schule gehalten werden.
Warum das so sei?
Auf diese Frage zuckt die Lehrerin hilflos mit den Schultern: Vielleicht weil die Fächer schwieriger wüeden? Vielleicht aber auch, weil viele der Kinder lieber in die örtliche Videothek gehen, ein „kleines Busyness“ betreiben oder einfach herumgammeln.
…ujutna“, Lachen
Regie: bei Bedarf hochziehen, abblenden
Zurück im Lehrerzimmer, versucht die Direktorin das beim Rundgang entstandene Bild zunächst noch ein wenig aufzuhellen:
O-Ton 4: Direktorin, II 0,38
„Eschegodno u nas prochodit kurse…
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Alljährlich besuchen unsere Leute Kurse zur Umschulung und Weiterbildung. Dort wird das Neue zur Pädagogik und zum Stoff angeboten. Dort werden zum Beispiel die neuen Standarts ausgegeben. Dort lernt man andere Schulen kennen, neue Ausbildungsformen, Lyzeen, Gymnasien, Hausunterricht, Familienunterricht, kompensatorischen Unterricht, Klassen mit pädagogischer Hilfe. Jeder nimmt da etwas für sich mit.“
..sebe prinimaem“
Erzähler: Wahlfächer anzubieten, ist unser Ziel, fährt sie fort. Eine Hilfsklasse für Kinder aus sozial schwachen Familien gibt es bereits, ebenso einen Schulpsychologen.
Dann aber bricht bei Frau Bjedkowa doch die Unzufriedenheit durch: Die Betreuung durch den Pionierclub kann der Schulspychologe nicht ersetzen, findet sie. Werte wie Patriotismus und Nächstenliebe verfallen so. Die Eltern haben sich zurückgezogen; gleichzeitig kann die Schule aber nur noch dank der Hilfe der Eltern existieren: Sie halten das Schulgebäude und die Klassenräume instand. Ohne die Eltern läuft nichts mehr.
Alles in allem ist es ein sehr ernüchterndes Resumee, das die Direktorin aus den letzten fünf Jahren zieht:
O-Ton 5: Direktorin, III 0,46
„Wsjo idjot po starumu…
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Alles läuft in alter Weise. Neues schaffen wir nicht. Wahlfächer können wir nicht wirklich anbieten. Nur klassenweise können die Älteren sich entscheiden. Berufserziehung schaffen wir ebenfalls nicht. Bei uns läuft alles wie es war. Und das Wichtigste: Es hat sich nichts an der Haltung zur Schule geändert! Mehr noch: Die Haltung des Staates gegenüber der Schule ist völlig gleichgültig. Wenn wir jüngere Lehrer hätten! Aber wir sind nun mal in diesem Kreis mit den alten. Neue können wir uns nicht leisten. Wir vegetieren mehr, als daß wir existieren. Es wird alles mögliche versprochen; seit fünf Monaten soll der Lohn kommen. Es ist einfach schwierig!“
… nu, tejelo!“
Erzähler: Als ich ihr mein Erstaunen darüber mitteile, daß ich bei dem Rundgang in der ganzen Schule nicht einen einzigen Mann gesehen hätte, eröffnet sie mir ein weiteres Problem:
O-Ton 6: Direktorin, IV 0,56
„Utschitelei mala…
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Ja, männliche Lehrer gibt es wenig! Die männlichen Absolventen der pädagogischen Hochschule gehen ins `busyness´, in irgendeinen Betrieb, wo man mehr verdienen kann. Das war schon früher so, aber jetzt wird es extrem. In unserem Land ist die Erziehung überhaupt Frauensache, zu Haus, im Kindergarten, in der Schule. Die Männer verdienen Geld für die Familie. Die Frauen kümmern sich, auch wenn sie arbeiten, abends noch um den Haushalt und die Kinder. Wenn es die Mutter nicht macht, macht es die Oma. So ergibt es sich, daß die Erziehung der neuen Generation ganz in den Händen der Frauen liegt.“
…vospitiwajut nowi pakalennije“
Erzähler: Wie in der „Schule 2“, so sieht es auch in den anderen Schulen des Ortes aus: Die Lehrerschaft wurschtelt sich durch. Die Eltern sind froh, überhaupt eine Schule zu haben. „In anderen Orten mußten Schulen bereits geschlossen werden“, meint die junge Bibliothekarin des Ortes, die mich zur Schule geführt hat. Sie hat selbst zwei Mädchen im schulplichtigen Alter.
Auf die Frage nach den Möglichkeiten der Weiterbildung antwortet sie:
O-Ton 7: Mutter in Ordinsk 0,24
„A, nu da..“; Frage von mir; Lachen: „Nu, ja nje snaju, u nas njet tagowo…
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Nein, ich weiß nicht. Wir haben hier solche Möglichkeiten nicht. Hier heißt es nur einfach: Schule! Da gehst Du hin und fertig, ob du willst oder nicht. Wir haben hier nicht diese Möglichkeiten wie in großen Städten, wie in Nowosibirsk, wo jetzt Colleges eröffnet werden und alle möglichen speziellen Richtungen. Nein, sowas gibt es hier nicht. Bei uns gibt es noch die Musikschule und das war´s dann.“
…musikalnaja schola i swjo“
Erzähler: Ja, eine Krise müsse man das schon nennen, findet sie. Aber wen wundere das bei der allgemeinen Krise des Landes? Darüber möchte sie schon gar nicht mehr reden. Alles ist so schwer geworden! Man kämpft sich durch! Lieber erzählt sie, wie sie und ihre Kolleginnen der örtlichen Bibliothek, auch alles Frauen, der abnehmenden Leselust der Ordinsker mit neuen Literaturangeboten zu begegnen versuchen. Auch das ist schwierig, denn die Leute haben anderes als Lesen im Sinne: Überleben!
So wie in Ordinsk, so ist es auch an anderen Orten. Die Krise ist unübersehbar. In einer ersten und zugleich der bisher letzten öffentlich zugänglichen Bilanz des russischen Ministeriums für Erziehung aus dem Jahr 1994 klingt das so:
Zitator: „Trotz aller positiven Veränderungen sieht sich das Bildungsystem einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber:
Die erste ist das Problem der staatlichen Finanzierung. Regelmäßiges Ausbleiben finanzieller Eingänge, der Mangel an Geld für Ausrüstung und den Bau von Gebäuden bewirkte: Den geistigen Abfluß aus dem Bildungsbereich und, als ein Ergebnis, eine eindeutige Vorherrschaft von Frauen und älteren Leuten unter den Lehrern; die Entstehung einer Anzahl von Institutionen im Bildungsbereich, die in Zwei- oder Drei Schichtbetrieb arbeiten; den Verfall der materiellen Basis.
Das Zweite Problem betrifft unsere mangelnde Erfahrung bei der Einrichtung innovativer Veränderungen in das praktische Schulleben. Das gesamte Bildungssystem mit all seinen Institutionen wurde im Grunde zum Experimentierfeld. Und dafür ist nicht nur ein Trainig im Innendienst nötig, sondern auch die Umwandlung der gesamten Mentalität der Lehrer, die Ersetzung ihrer Stereotypen.“
Erzähler: Die staatliche Bilanz, obwohl recht offen, dringt doch nur bis zur halben Wahrheit vor. Die ganze Wahrheit wird erst offenbar, wenn man die Veränderungen, insbesondere seit 1991, noch genauer betrachtet:
Nehmen wir Borodino, eine Stadt von ca. 25.000 Einwohnern in den Kohlerevieren des Krasnojarsker Gebietes im südlichen Sibirien. Vor Anbruch der neuen Zeit gehörte die Stadt ihrer reichen Kohlevorkommen wegen zu den wohlhabenden Orten des Landes. Noch in ihrem Jahresbericht von 1990 rühmte sie sich, neben anderen sozialen Leistungen mit dem Bau einer neuen allgemeinbildenden Schule für 1176 Plätze begonnen zu haben.
Im Sommer 1992, nur ein Jahr nach Beginn der radikalen Privatisierung, klagt Maria Solocha, pensionierte, aber dennoch weiter tätige Lehrerin, verbittert über den Niedergang der Schulen des Ortes:
O-Ton 8: Maria Solocha 0,42
„Vot, nu w etom godu…
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „In diesem Jahr, also 1992, war es schon vorbei. Früher war das Kohlekombinat Chef der Schulen. Sie gaben uns Geld, finanzierten die Ausrüstung, richteten uns eine Computerklasse ein, besorgten uns technische Mittel. Seit dem Putsch von 1991 ist das vorbei. Jetzt kümmert sich das Kombinat nur noch um die eigenen Leute. Wer dort Arbeit hat, dem geht es gut, wer nicht, der lebt schlecht. Von den wenigen Steuern, die die Stadt jetzt bekommt, kann sie nichts bezahlen. Es ist alles irgendwie aus den Fugen.“
… kakaja neuwjastna.“
Erzähler: Die Privatisierung, zeigt sich, führte nicht nur zur Kündigung der sozialen Verantwortung von oben, sondern zugleich auch von unten. Von oben zog sich der Staat, von unten zogen sich die nunmehr privatisierten Betriebe aus ihren sozialen und bildungspolitischen Verpflichtungen. Sie wurden durch Steuern ersetzt, die oft nicht gezahlt werden und von denen ein großer Teil zudem noch nach Moskau abgeführt werden muß. Zurück blieb eine zahlungsunfähige Kommune, die ihre Schulen und andere soziale Einrichtungen nur noch auf der Basis von persönlichem Enthusiasmus der dort Angestellten und Zuwendungen einiger einsichtiger Sponsoren betreiben kann. Daß die so Verbleibenden nach Lage der Dinge nicht nur Enthusiasten, sondern vor allem auch ältere Leute sind, die sich mit den neuen Verhältnissen nicht abfinden wollen oder können, liegt auf der Hand. Frau Solocha macht daraus kein Geheimnis:
O-Ton 9: Maria Solocha, II 0,25
„No, wot wi snaetje…
Regie: kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerinhochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Wissen Sie, jetzt gibt es ja neue Schulbücher. Dort ist Lenin rausgesäubert. Aber ich bin mit ihm aufgezogen worden. Ich mache meinen Unterricht mit ihm. Ich erzähle von ihm, was er war, was er gemacht hat, alles erzähle ich. Keiner verbietet uns das.“
… nje sprischajut.“
Erzähler: Statistisch ist nicht ausgewiesen, wieviele Pensionäre, vor allem in kleineren und mittleren Städten des Landes sowie in den Dörfern auf diese Weise im Beruf gehalten werden. Der von ihnen ausgehende konservative Einfluß unterliegt aber wohl keinem Zweifel.
Die Bestandsaufnahme wäre nicht vollständig, würden wir uns nicht auch den Folgen genauer zuwenden, die die Auflösung der Jugendorganisationen der Partei im Jahre 1991 und die anschließende Aufhebung der Wehrerziehung als Pflichtfach in den Schulen und anderen Bildungsanstalten nach sich gezogen hat.
Die „Jungen Pioniere“ nahmen früher die Sechsjährigen auf, wenn sie den Kindergärten entwachsen waren. Die „Komsomolzen“ umfaßten den gesamten Jugend-Freizeitbereich. Jugendzentren, Feriencamps, Kulturveranstaltungen lagen in ihren Händen. Für die ganz Kleinen gab es die Krippen, für die Älteren die „Häuser der Kultur“. Vermittelnd zwischen allem stand die örtliche Bibliothek.
Jede Ansiedlung, von den Sowchosen aufwärts bis hin in die großen Metropolen war mit mindestens einem, sagen wir, Set dieser Struktur versehen. Träger waren Sowchosen, mehrere örtliche Betriebe, manchmal auch nur ein einziger. In manchen Städten, wie in Borodino, unterhielt ein einziges Unternehmen sämtliche Einrichtungen der Stadt.
Die Auflösung dieser Struktur und der Übergang von kostenloser Rundum-Versorgung auf ein selbstfinanziertes Angebot offenem Markt bedeutete für viele dieser Institutionen bereits das Aus. Nur die Kräftigsten überleben und auch diese, wie schon die Schulen, nur auf der Basis uneigennützigen Enthusiasmus des jeweiligen Direktors und einer ihm verschworenen Gemeinschaft:
In Perm am Ural treffen wir auf ein solches Kollektiv. Es ist das Kinderhaus der früheren Leninwerke. Das ist ein ehemaliger sowjetischer Musterbetrieb der Schwerindustrie, 1965 gegründet, 30.000 Beschäftigte. 1500 Kinder wurden seinerzeit hier versorgt. Direktor Nikolai Alexandrow, ein quirliger Mittvierziger, ist selbst hier aufgewachsen. Befragt, was sich durch die neue Zeit geändert habe, erzählt er:
O-Ton 10: Direktor des Kinderhauses in Perm 0,50
„Nu, preschde swjewo ismenilas…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf am Ende hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Nun vor allem gab es Änderungen in Sachen Finanzen. Anfangs war das ein von der Gewerkschaft betriebenes Haus der Kultur. Das heißt wir lebten von den gewerkschaftlichen Geldern. Jetzt hat sich die Lage in unserem Lande geändert. Wir müssen uns vollkommen selbst finanzieren. Die Führung des Hauses, alle kreativen Tätigkeiten, die Löhne für die Mitarbeiter und schließlich noch die Nahrung für die Kinder müssen wir selbst erarbeiten. Und was das Tollste ist: Wir müssen auf das alles auch noch Steuern bezahlen wie irgendeine Konservenfabrik. Wie ich bei all dem auch das schöpferische Niveau unseres Hauses halten soll, ist mir ein Rätsel. Das gibt es doch in keinem zivilisierten Lande! So kann man keine Bildung und schon gar keine Kultur an die jungen Leute vermitteln.“
..schtobi suschustwowats.“
Erzähler: Trotzdem versucht er sein Bestes. Kurse werden gegeben: Tanz, Töpferei, Literatur, Theater und Landeskunde. Die neueste Errungenschaft seines Hauses ist die Einrichtung einer „Schule der Auferstehung Marias“. Sie soll den Kindern das entstandene ideologische Vacuum durch Beschäftigung mit den Werten echter russischer Kultur ersetzen.
Ohne Wassiljew und seine Truppe säßen die Kinder auf der Straße. Für die Lehrerschaft ist Wassiljew Rettung aus höchster Not. Sie treffen sich bei ihm, sie schicken ihre Kinder zu ihm, er ist ihr Berater, der Vermittler und Organisator des kulturellen Überlebenswillens. Selbst das zentrale „Kulturhaus“ der Stadt, früher ebenfalls von der Gewerkschaft getragen, bezieht Impulse von ihm.
Lange aber kann das nicht so weitergehen. Schon jetzt fehlt es an allen Ecken. Wassiljew kann seine Mitarbeiterinnen, auch hier fast nur Frauen, nicht mehr bezahlen. Die Kinder, die oft nur noch beschäftigt werden können, wenden sich attraktiveren Akltivitäten, nicht zuletzt dem „kleinen busyness“ zu.
Wassiljew klagt bereits über abnehmende Gesundheit. Irgendwann wird er zusammenbrechen. Dann muß das Haus geschlossen werden. Ein anderer wird diese Arbeit, von der man nicht einmal die Familie ernähren kann, nicht übernehmen. Eine Alternative gibt es nicht.
O-Ton 11: Kinderhaus in Dudinka 1,29
Kinderhaus, Kinderstimmen…
Regie: langsam kommen lassen, kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, verblenden
An anderen Orten ist die neue Zeit scheinbar spurlos vorbeigegangen.
So an Dudinka hoch im Norden an der Mündung des Jenessei, wo die Sonne im Sommer nicht unter, im Winter dafür aber auch nie richtig aufgeht.
Dudinka ist die Hauptstadt eines autonomen Kreises, der seinen Namen von den dortigen Ureinwohnern der Nenzen bekommen hat. Gut 45.000 Menschen leben in diesem Gebiet.
Hier im zentralen Kinderhaus der Stadt liegt noch alles fest in einer Hand. Die Kinder kommen soeben vom Essen in der Schule. Jetzt werden sie den Nachmittag hier verbringen, musizieren, basteln oder auch Exkursionen machen, um die Gegend kennenzulernen. Fünf Gruppen gibt es von je 25 Kindern. Alles ist kostenlos, selbstverständlich. Das Kinderhaus ist gleichzeitig Kulturzentrum.
Hier wird die neue Zeit vor allem als Problem wahrgenommen. Auf die Frage, ob sich die Kinder verändert hätten, antwortet eine der dort tätigen jungen Frauen:
O-Ton 12: Kindergärtnerin in Dudinka 0,29
„Da, otschen drugije…
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Ja, sie sind sehr anders. Ich beurteile das natürlich nur nach mir selbst. – Wir waren gutmütiger, denke ich. Heut haben sie irgendwie eher Geld im Kopf. Ich habe auch selbst noch zwei Kinder. Von all dem weiß ich, daß ich mehr gelesen habe. Heut wollen sie vor allem Videos.“
… bolsche widiki!
Erzähler: Im Kinderhaus von Dudinka gilt noch die Pionierordnung: Betten in Reih und Glied, Antreten zur Mittagsruhe, gemeinsamer Abmarsch. Die Veränderungen der letzten zehn Jahre, Sowjetunion, Perestroika und anderes sind hier kein Thema. Wofür auch, meint die junge Frau, mit ihr habe auch keiner geredet. Altes Denken und neue Gleichgültigkeit gehen hier direkt ineinander über.
Verwahrlosung auf der einen, Bevormundung auf der anderen Seite, häufig, wie hier in Dudinka, fatal miteinander verquickt, sind die beiden extremen Folgen der Entstaatlichung der vor- und außerschulischen Bildungspolitik.
Die Auswirkungen treffen zunächst vor allem die Familie und in der Familie wiederum die Mütter, bzw. Großmütter, die Babuschkas. Rußland erlebt eine Renaissance der Großmütter. Sie kümmern sich um die Versorgung des Haushaltes, der Datscha und der Enkelkinder.
Viele Frauen werden heute unfreiwillig in diese Rolle zurückgedrängt. Eine Babuschka, die diese Rolle im Alter von zweiundfünzig Jahren freiwillig übernahm, begründet ihren Schritt so:
O-Ton 13: Babuschka 0,38
„Ja ponimaju, schto ja…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin Ende hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Ich sehe, daß sie mich brauchen. So haben sie ausreichend Zeit für ihre Angelegenheiten, für ihre Arbeit. Wenn es mich bei ihnen nicht gäbe, müßten sie ganz anders arbeiten. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen sollte. Da wären sie gezwungen, einzeln irgendwohin zu gehen, der eine mit den Kindern, die andere irgendwohin. Jetzt ist es so: Ich sitze bei den Kindern und sie sind frei.“
…ani swabodni.“
Erzähler: Glücklich die Familie, die eine solche Babuschka hat, vielleicht sogar zwei. Viele Familien aber, zumal wenn es keine Babuschka gibt, werden unter den Anforderungen des heutigen Überlebenskampfes zerrieben, sodaß sie keine Kraft mehr finden, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die offizielle russische Statistik versagt vor dieser Entwicklung. Arbeitsgruppen der Ruhr-Universtät Köln haben die wenigen Daten, die immer wieder durch die russische Presse gingen, in ihrem „Halbjahresbericht zur Bildungspolitik in Rußland“ zusammengefaßt. Diese Daten sprechen eine erschreckende Sprache:
Zitator: „Im Dezember 1992 waren 80 200 Kinder – Waisen, Halbwaisen und solche, die von ihren Eltern verlassen wurden – in 577 Heimen, 247 Kinderhäusern und 140 Internaten untergebracht. 20 500 verurteilte Jugendliche, davon 1200 Mädchen, befanden sich in Besserungsanstalten. Die Zahl der jährlich von Jugendlichen verübten Straftaten wurde mit über 200 000 beziffert.
Der prozentuale Anteil der Delikte, die von Jugendlichen begangen wurden, hat seit 1990 beständig zugenommen. Zu den häufigsten Verbrechen gehören: Diebstahl, Raub, Körperverletzung, Vergewaltigung, Prostitution und Drogenkriminalität. 65-85% der von Jugendlichen verübten Delikte sind unter dem Einfluß von Alkohol begangen worden.
Die zu Sowjetzeiten übliche Tabuisierung gesellschaftlicher Probleme, einschließlich `abweichenden Verhaltens´ von Kindern haben eine Hilflosigkeit von Eltern und Pädagogen, Medizinern und Psychologen gegenüber diesen Erscheinungen zur Folge, die zu einer Sprachlosigkeit zwischen den Generationen führt.“
Erzähler: Das „Sich vernachlässigt-Fühlen“, fahren die Kölner Beobachter fort, ist nach Ansicht russischer Psychiater die Hauptursache für die steigende Zahl von Selbstmorden und Selbstmordversuchen nicht nur unter Erwachsenen, sondern auch unter Jugendlichen. Die ungeleitete neue sexuelle Freizügigkeit führt zu einem sprunghaften Anstieg von Abtreibungen an minderjährigen Mädchen.
Ganz zu schweigen davon, eine Entlastung für die krisengeschüttelte Schule zu sein, ist das staatliche Fürsorgesystem selbst in einer tiefen Krise.
Drastisch beschreiben russische Praktiker die Lage, so Iwan Mitrofan, Dozent an der pädagogischen Hochschule von Tscheboksary an der Wolga:
O-Ton 14: Iwan Mitrofan, Dozent für Päadagogik 1,55
Deutscher Originaltext
Regie: Ganz durchlaufen lassen
„Die Pädagogik steht nicht isoliert unter anderen Wissenschaften und anderen Wissensbereichen. Die Erfolge auf dem Gebiet der Pädagogik hängen nicht nur von diesem engen Bereich ab, sondern auch davon, wie es oben organisiert ist. Ich habe oft daran gedacht: Pädagogik, ja, Wissenschaft! Aber gibt es Bildung unter den Tieren? Es gibt doch die Füchse und ihre Kinder, die Wölfe und ihre Kinder, die anderen, ja? Sie sind andres, verschieden unterrichtet sozusagen. Aber wie? Sie ahmen die Eltern nach. Das heißt, die Eltern machen es so und die Tierkinder machen ebenso. Aber bei den Menschen kommt etwas anderes vor: Die Erzieher, nun, erziehen bei den Schülern solche Eigenschaften und wollen erziehen, aber sie machen das nicht. Um es in der Erziehungssache besser zu machen, müssen alle von der Lebenstreppe sehr gewissenhaft und anständig sein, ja.“
…lacht
Erzähler: Aber nicht nur der Schulbereich und sein Umfeld, auch Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung befinden sich in einer tiefen Krise.
Der „Tag des Wissens“ war zu Sowjetzeiten ein stolzer Feststag zu Beginn eines jeden Schuljahres. Unbestreitbare Leistungen des sowjetischen Bildungssystenms standen in seinem Mittelpunkt wie die Überwindung des 60prozentigen Analphabetismus der vorrevolutionären Zeit durch die allgemeine Volksbildung, wie der Durchbruch zur wissenschaftlichen Führungsmacht mit dem Spart des ersten Weltraumsatelliten.
Auch heute ist der „Tag des Wissens“ noch offizieller Feiertag. Für viele ist aber gerade dieser Tag inzwischen zum Protesttag geworden.
Selbst in braven Provinzstädten wie dem Tschboksary des soeben zitierten Hochschuldozenten Mitrofan ziehen Gruppen unzufriedener Jugendlicher durch die Straßen. Sie halten sich mit Alkohol künstlich bei Laune und machen kein Hehl aus ihrem Unmut:
O-Ton 15: Jugendliche in Tschboksary 1,33
Junger Mann: „Djen snannje?…
Regie: Langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende wieder hochziehen, abblenden
Erzähler: „Wir machen einen drauf!“ witzeln sie.
„Der Tag des Wissens“, meint einer, „das ist unser zukünftiges Wissen. Das ist unsere Zukunft.“
„Früher hieß es: Voran zur Ausbildung!“ meint ein anderer, „aber jetzt? Jetzt mußt du der Beste sein, um was zu kriegen.“
„Ich möchte Wirtschaftsfachmann werden“, meint ein Dritter: „Aber es gibt keine Plätze. Selbst als Bester kriegst du nichts. Man braucht unheimlich viel Geld, von der Familie, für den Unterhalt und all das. Das kann sich nicht jeder leisten.“
„Genau, sie haben es so organisiert, daß 30% keinen Platz kriegen“, ruft ein weiterer: „Ich zum Beispiel falle unter diese 30%, obwohl ich die Uni mit Auszeichnung gemacht habe.“
„Wir erwarten nichts“, sagt ein Mädchen, „man nimmt die jungen Leute nicht zur Arbeit.“
„Unser Rußland ist groß! Es wird schon wieder auf die Beine kommen!“ pöbeln die Jungs schließlich, nicht mehr ganz nüchtern.
…charascho, spassiba.“
Erzähler: Mehr als nüchtern dagegen ist die Bestandsaufnahme zur Lage seitens Professor Oleg Melnikows in Nowosibirsk. Er kann die Stimmung der jungen Leute verstehen. Er ist Dozent für Ingenieurswesen und Philosophie am Institut für Verkehrswesen in der sibirischen Metropole, früher ein hoch angesehener Spezialist in der Ausbildungshierarchie.
Dazu muß man wissen, daß es im Ausbildungsgang der sowjetischen Zeit keine Lehrberufe, dafür aber neben den Universitäten eine ganze Palette von spezialisierten Instituten und Akademien gab, deren Abschluß zur Aufnahme der entsprechenden Facharbeit befähigte – und früher auch automatisch berechtigte.
Institute wurden entweder überhaupt – wie das Institut für Verkehrswesen – von Betrieben oder Betriebsverbindungen getragen oder es wurden langfristige Übernahmeverträge mit Betrieben geschlossen. Auf diese Weise wußten die Studierenden bereits bei Beginn ihres Studiums, wo sie später arbeiten würden – vorausgesetzt sie bestanden die entsprechenden Prüfungen.
Heute sind diese Verbindungen gelöst, genauso wie im schulischen und im außerschulischen Bereich.
Gegen die Auflösung des schematischen Einheitsunterrichts zugunsten von Standards mit Vorschlagscharakter hat Professor Melnikow nichts einzuwenden. Auch nicht gegen die gewachsene Eigenverantwortlichkeit der Direktoren und Rektoren. Veränderungen waren unumgänglich, findet er. Höchst problematisch aber findet er das, was er die schleichende Beseitigung des Rechts auf kostenlose Ausbildung nennt:
O-Ton 16: Oleg Melnikow, Institut für Verkehswesen 1,00
„Eto paraschdajet otschen…“
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Das ruft äußerst ernste Probleme hervor. Früher kam man per Wettbewerb auf die Institute. Da kamen nur sehr gute Leute durch. Und heute? Heute hat der Staat die Finanzierung wissenschaftlicher Institute nahezu eingestellt. Er zahlt nur die Stipendien der Studenten und das Gehalt der Dozenten. Dadurch wurde das Institut gezwungen, eigene Mittel aufzubringen und mußte zur Selbstversorgung übergehen. Es sind einige staatlich finanzierte Plätze erhalten geblieben, auf die man per Wettbewerb kommt. Aber wer es nicht im Wettbewerb schafft, der schafft es dann, in Gottes Namen, wie auch immer, über Geld. So ist die gegenwärtige Krise entstanden! Bisher hat sie uns ein gewaltigen Absinken des Bildungsniveaus beschert.“
…snischennije uriwina.“
Erzähler: Dazu kommt, fährt der Professor fort, daß die Stipendien und die Gehälter sehr niedrig sind; außerdem werden sie schon seit Monaten nicht gezahlt. Früher hoch angesehene Leute werden zu Bettlern. Die Besten gehen unter solchen Umständen in die Wirtschaft.
Auch die Zahl der Studenten sank in den Jahren seit 1991. 1995 allerdings stieg sie erstmalig wieder. Warum?
O-Ton 16: Prof. Oleg Melnikow, II 0,43
„No w etom godu…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Für den neuen Andrang gibt es zwei Gründe: Erstens, das Studium befreit zur Zeit vom Militärdienst. In Tschetschenien umkommen, das will keiner. Das Zweite ist die Arbeitslosigkeit. Die Eltern, wie es häufig geschieht, kommen her, bereden sich mit uns: `Was sollen wir fünf Jahre mit ihm machen? Besser er lebt am Institut, nach fünf Jahren sehen wir weiter. Vielleicht herrschen dann andere bedingungen.´“
…ostanowki ismenilis.“
Erzähler: Als Gegenleistung unterstützen die Eltern das Institut persönlich oder über ihren Einfluß in Institutionen. Ohne die Hilfe der Eltern können auch die Institute heut nicht existieren.
Hier wird deutlich, worüber die jungen Leute sich empören: Wer keinen entsprechenden Hintergrund hat, kommt gar nicht erst auf ein Institut. Ganz zu schweigen davon, ob er oder sie mit der dort erlangten Ausbildung einen Arbeitsplatz findet. Außerbetriebliche Arbeitsvermittlung ist in Rußland von heute ein Wort, das eine fremde, nämlich westliche Realität beschreibt. In Rußland wirkt heute ein Mischsystem aus traditioneller Patronage und Anarchie.
Dazu kommt, daß die Kurve der Arbeitslosigkeit, heute noch offiziell bei 3,5 Prozent gehalten, bei Fortsetzung des jetzigen Wirtschaftskurses schnell auf 15 Prozent ansteigen könnte.
Erzähler: Nicht weniger problematisch als die wirtschaftliche Seite der Krise findet Professor Melnikow ihre ideologische:
O-Ton 18: Prof. Melnikow, III 0,36
„Nu, pakasiwaitsja tak…
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
Übersetzer: „Nun, einfach ausgedrückt, ist es so: Wir haben in Sachen Ideologie gesagt: Was war, war schlecht. Aber eine neue Ideologie, die für Russen annehmbar wäre, gibt es noch nicht. Dieser leere Platz ist eine erschreckende Sache. Das heißt, man hat hier das biblische Gebot verletzt, welches da heißt: Wenn Du die neue Kirche noch nicht gebaut hast, zerstöre nicht die alte; andersfalls gibt es keinen Ort, wo man betet. Heute befinden wir genau in dem Zustand, in dem es keinen Ort zum Beten gibt. Heute hängt alles von den jedem Einzelnen, also auch von jeden einzelnen Lehrer ab. Das ist in gewissem Maße gut, aber wenn es keine bestimmte Ideologie gibt, die alle verbindet, dann ist das schlecht.“
…eta plocha.“
Erzähler: Von der These, daß die russische Bevölkerung überqualifiziert sei und die zukünftige Bildung auf ein verwertbares Maß reduziert werden müsse, hält der Professor nichts. Erstens sei sowjetische Bildung durchaus an Effektivtät orientiert gewesen; zweitens sei das Recht auf Bildung ein unveräußerliches Menschenrecht und Kulturziel. Damit habe die sowjetische Bildungspolitik ernst gemacht und so den 60prozentigen Analphabetismus vom Anfang des Jahrhunderts überwunden. Der Kult des Geldes und des Pragmatismus könne eine Ideologie wie den Marxismus, der ein gemeinschaftliches Ziel gesetzt habe, nicht ersetzen, ebensowenig wie Newtons Mechanik durch spätere Erkenntnisse der Relativitätstheorie und Quantenphysik außer Kraft gesetzt werde. Jedes gelte auf seiner Ebene. „Das Wichtigste ist“, findet der Professor, „daß es keine Abbrüche gibt“.
Abbrüche möchte auch Pjotr Reschetka vermeiden. Er ist Vorsitzende des „Komitees für Wissenschaft und den wissenschaftlich-technischen Komplex des Nowosibirsker Verwaltungsbezirks“.
Er ist damit Vertreter einer der profiliertesten wissenschaftlichen Verwaltungseinheiten der russischen Föderation: Die Nowosibirsker „Akadam Gorod“, zu deutsch Wissenschaftsstadt, ist nach Moskau das wichtigste Zentrum russischer Wissenschaft und Technik. Hier war der sogenannte militärisch-industrielle Komplex Sibiriens konzentriert. Anfang der Achtziger waren es die Wirtschaftsforscherinnen und -forscher der „Akadem Gorod“, von denen die wissenschaftlichen Startzeichen für Gorbatschows Perestroika ausgingen. Sie entwarfen die ersten Umbau-Programme.
Kein Wunder, daß der Vorsitzende dieses mächtigen Komitees von einer Krise der Bildung und Wissenschaft zunächst nichts hören will. Die Krise ist für ihn nur Ausdruck notwendiger Veränderungen, „schwierig, aber keineswegs ausweglos“. Die Regierung, findet er, tut, was sie kann, anders könne es gar nicht sein:
O-Ton 19: Pjotr Reschetka 1,12
„Eta sjasena tem schto…“
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Das hängt damit zusammen, daß die Regierung unabhängig von der wirtschaftlichen Situation des Landes einfach gezwungen ist, in die Bildung zu investieren, weil das sonst sofort äußerst tiefgehende soziale Erschütterungen nach sich zieht. Allein in Nowosibrisk werden mehr als 100 000 junge Leute ausgebildet. Es folgen dann weitere 15 Jahre an Berufsschulen, Colleges, Technika, danach an Hochschulen. In dieser aktiven Zeit treiben die jungen Menschen sich nicht herum; sie geraten nicht in kriminelle Strukturen, sondern halten sich im intellektuellen Raum auf. Wenn auch unter ärmlichen Bedingungen, befinden sie sich auf diese Weise doch unter beständigem Ausbildungsdruck, wo sich ihre Persönlichkeit bildet. Nach der Hochschule fällt solchen jungen Menschen schwer, sich in Banden zu organisieren.
Das ist die eine Seite der Sache. Die andere ist: Sie als Verbrecher ins Gefängnis zu setzen ist teurer, als sie in der Schule oder im Institut auszubilden.“
…schkole i institute.“
Erzähler: Spricht schon diese Rechnung nicht unbedingt die Sprache der Reform, so beweist das, was Professor Reschetka dann an, wie er es nennt, „rein organisatorischen Problemen“ aufzählt, daß die Krise auch vor dem Bereich von Wissenschaft und Forschung nicht Halt macht. Im Gegenteil, sie führt auch dort zu schweren Einbrüchen:
O-Ton 20: Reschetka, II 0,38
„Vot swoje i u rabote komiteta…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Das ist erstens das Fehlen einer normativen Basis, das heißt ungenügende gesetzliche Regelungen für die Finanzierung. Nach wie vor werden Grundentscheidungen in Moskau getroffen, obwohl die Verfassung und der Föderationsvertrag festlegen, daß Fragen von allgemeinem wissenschaftlichen Interesse gemeinsam entschieden werden sollen. Aber welcher Jurist kann heute sagen, was Fragen von allgeminem Interesse sind? Keiner. Ebensowenig ist klar, was gemeinsame Beratungen sind.“
… Moskwje.“
Erzähler: Nach einem kurzen Ausflug zur möglichen zukünftigen Rolle Sibiriens fährt er fort:
O-Ton 21: Reschetka, III 0,46
„Wtaroi problem…“
Regie: kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Es ist zweitens das, was man das „Abließen des Geistes“ nennt. Dabei geht es um das Weglocken von jungen Spezialisten in den Westen. Wir tragen die Kosten für die Ausbildung der jungen Leute, dann kommen Westfirmen und holen die ferigen Spezialisten für ein Bettelgeld. Auf diese Weise hat unsere „Akadem Gorod“ bereits 4000 Akademiker verloren. 120 arbeiten jedes Jahr vorübergehend im Ausland.“
…nischesti djengi.“
Erzähler: Die Privatisierung der Wohnhäuser bezeichnet der Professor als drittes Problem. Früher vom Staat seinem wisenschaftlichen Personal in der geschlossenen Exklave der „Akadem Gorod“ zur Verfügung gestellte Dienstwohnungen stehen nach der Privatisierung heute zum Verkauf. Leute mit Geld, manche nicht einmal aus Nowosibirsk, kaufen sich in der „Akadem Gorod“ ein, während die unterbezahlten Dozenten, Wissenschaftler und das wissenschaftliche Personal in die Stadt, in deren Randbezirke oder gar noch weiter abgedrängt werden. Das Problem betrifft das ganze Land und alle staatlichen Strukturen. Es ist vor Ort praktisch nicht lösbar. Moskau aber unternimmt nichts.
Professor Reschetkas Versuch, die Bildungspolitik der Regierung zugleich zu beschönigen und zu kritisieren, zeigt mehr als er verbergen kann: In ihm wird zum einen die Naivität eines Professors erkennbar, den es vorübergehend in die Politik verschlagen hat, der aber noch nicht gelernt hat, diplomatisch zu reden. Das sagt einiges darüber aus, wie heute in Rußland Politik gemacht wird.
Zum zweiten gibt er einen kurzen, aber äußerst informativen Blick auf die Kosten-Nutzen-Rechnungen frei, die in höheren Etagen der russischen Politik heute angestellt werden. In ihnen wird Bildung nicht gegen Unbildung, Rückständigkeit nicht gegen Fortschritt abgewogen, sei er vermeintlich oder wirklich, sondern vor allem Kosten gegen Gewinn.
Was dabei, entgegen den Berechnungen Professor Reschetkas und anderer Reformer herauskommt, wird in der Studie der Ruhr-Universität schon 1994 so zusammengefaßt:
Zitator: „Mit der Bestimmung, 10% des Nationaleinkommens jährlich für die Bedürfnisse des Bildungswesens aufzuwenden, wollte das Bildungsgesetz von 1992 die `Priorität´ dieses Bereiches unterstreichen. Dieser Anteil ist nie auch nur ansatzweise erreicht worden, im Gegenteil: Der Rückkgang der Produktion und die Inflation haben die Krise der Staatsfinanzen beschleunigt. Die Folgen:
– seit 1992 ist ein starker Rückgang der Ausgaben für den Bildungsbereich im Staatshaushalt zu verzeichnen;
– 1993 und 1994 ist der Staat den Zahlungsverppflichtungen nur zum Teil nachgekommen, Lehrergehälter und Stipendien wurden mit mehrmonatiger Verspätung oder gar nicht ausgezahlt, kommunale Dienstleistungen (Energie, Heizung) wurden nicht bezahlt.“
– die den Lehrkräften aller Ebenen zugesagte Verbesserung ihrer Einkommen ist weit von einer Realisierung entfernt, auch wenn 1992 eine neue Tarifstruktur eingeführt wurde, sodaß sich ein Teil der Lehrkräfte und der Wissenschaftler am Rande des Existenzminimums befinden.“
Erzähler: Faktisch war der Abbau der vom „Internationalen Währungsfond“ diagnostizierten Überqualifikation damit eingeleitet. Die Ausblutung der Staatsfinanzen durch den Krieg in Tschetschenien hat diese Entwicklung in den letzten beiden Jahren erheblich verschärft. Ohnehin ist es die nationale Frage, die überhaupt erst ins Zentrum der Probleme führt. Auch nach Abtrennung der Länder der „Gemeinschaft unabhängiger Staaten“ umfaßt das heutige Rußland, je nach Zählweise, ja immer noch zwischen 100 und 200 Völkerschaften. Deren größte sind die Russen mit über 200 Millionen; ihre kleinste sind sibirische Nomaden, deren Verband nur wenige Familien zählt.
Die Reformer sind sich der Bedeutung, welche die nationale Frage für die Bildungspolitik hat, voll bewußt.
So schreibt Wladimir Schdrikow. Er ist stellvertretender Vorsitzende des moskauer „Komitees für Hochschulangelegenheiten
beim Wissenschaftsministerium und für das Hochschulwesen sowie die Technikpolitik Rußlands“, also ein Vorgesetzter der genannten Nowosibirsker Kommission:
Zitator: „Das anstehende Ausmaß unserer bildungspolitischen Reformpolitik ist sehr groß. Im Lande sind zur Zeit mehr als 250 000 Lehranstalten tätig; in ihnen werden mehr als 100 Millionen Menschen ausgebildet. Der Unterricht erfolgt dabei in 44 Sprachen. Diese Lehranstalten haben derzeit eine bisher unbekannte Autonomie erhalten. Freilich stehen wir erst am Anfang eines zum Teil noch diffusen, aber zweifellos langen Weges. Ich möchte nochmals betonen: Die Schule muß sich von einer Stätte formaler Aufklärung zu einem Zentrum ethnischer, nationaler und in jedem Fall lebendiger Kultur verwandeln. Dabei darf es nicht zur Entwicklung einer transkulturellen Monokultur kommen, sondern es muß ein Dialog der Kulturen und eine ethnische bzw. nationalübergreifende humane Verständigung erreicht werden.“
Erzähler: Grundlage für eine solche Politik wären seit 1993 jene Paragraphen der neuen russischen Verfassung, die neben dem Recht auf Bildung auch das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache im Alltag, im Unterricht, in der Verwaltung und für schöpferische Tätigkeit garantieren.
Grundlage wäre auch das „Gesetz über Bildung“ von 1992, das den regionalen Organen weitgehende Entscheidungsbefugnis über die konkrete Ausformung und Durchführung der allgemeinen Bilgungsrichtlinien zuspricht.
Auf dieser Grundlage sind in ethnisch bestimmten Republiken, Kreisen und Städten tatsächlich zahllose Initiativen ergriffen worden. Vor allem große ethnisch bestimmte Republiken wie Tatarstan, Tschuwaschien, die ihre Namen nach den dort konzentrierter als anderswo lebenden nichtrussischen Völkerschaften tragen, haben sich auf Zweisprachigkeit umgestellt. Dort treten jetzt Kräfte hervor, die lange im Untergrund, vor allem in den Dörfern, gewachsen sind. Das läßt dort heute manche muttersprachliche Dorfschule neu entstehen. Ja, die dörfliche Kultur erweist sich als der eigentliche Nährboden für die muttersprachlichen Impulse, die von den Intellektuellen der Städte ausgehen.
Rosa Juchma, zweite Vorsitzende des „tschuwaschischen Kulturzentrums“ in Tscheboksary an der Wolga, das sich der „Wiedergeburt der tschuwaschischen Kultur“ verschrieben hat, ist sogar der Meinung::
O-Ton 22: Rosa Juchma, Kulturzentrum in Tschuwaschien 0,55
„Da, esteswenna, esteswenna…“
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf am Ende hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Ganz sicher ist es so: Auf dem Dorf sind die Wurzeln tief im Volk verankert. Ich weiß es auch aus eigener Erfahrung: Ich lebte ja auf dem Dorf, wo ich nichts hatte, woran ich mich entwickeln konnte. Trotzdem konnte ich in der ersten Klasse der pädagogischen Hochschule mit denen Schritt halten, die von der ersten Klasse an hier in der Stadt gelernt hatten. Das ist heut nicht anders. Wir hatten vor allem anderen gelernt zu arbeiten – sähen, mähen, ernten, Kühe melken, alles, was mit Hofarbeit zu tun hat, Sie verstehen? Das verbindet den Menschen mit seinen Wurzeln. So kriegt man wohl auch größere Achtung vor dem Menschen überhaupt. Ja, es könnte schon sein, daß die innere Kultur dort letztlich höher ist als in der Stadt. Kann schon sein, daß dort Kräfte entstehen, die die krise überwinden.“
… tam wische.!
Erzähler: Frau Juchmas Optimismus steht im Widerspruch zum Zorn der Jugendlichen, ungeachtet, ob Tschuwaschen oder Russen, denen man am „Tag des Wissens“ in derselben Stadt begegnen konnte. Beides aber ist Realität. Mehr noch: Während Tschuwaschien, Tatarstan oder andere Wolgarepubliken, in Maßen auch noch der sibirische Altai oder das der Mongolei benachbarte Chakasien getragen von ihren ethnischen Realitäten zweisprachigen Unterricht in Schulen, Instituten und den örtlichen Universitäten aufbauen, bleiben ähnliche Versuche anderswo Initiativen auf dem Papier.
So etwa in dem schon erwähnten Dudinka hoch im Norden. Im „Museum für nationale Minderheiten“ kümmern sich dort vier Frauen mit viel Liebe und großem Einsatz um die Geschichte und Gegenwart der sibirischen Ureinwohner, der Nenzen, Jewenzen und Dolganen. Von ihnen leitet der autonome Kreis seinen Namen ab. Aber sie stehen auf verlorenem Posten:
O-Ton 23: Museum für Völkerkunde in Dudinka 1,05
„U nas tosche finanzowi problemi…“
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Auch wir haben finanzielle Probleme. Wir haben hier jetzt zwar so ein „Zentrum für Lehrerausbildung“. Dort gibt es spezielle nationale Programme, Lehrgänge, Schulen. Das heißt, es gibt durchaus gute, ausgebildete Leute, die in Leningrad gelernt haben. Eine Frau kommt selbst aus einem der Stämme. Sie beschäftigt sich mit den Problemen der nationalen Schule, also: wen unterrichten, wie unterrichten, in welchem Umpfang, damit es gebildet, und doch zugleich hilfreich ist. Aber die Mittel sind dürftig! Das ist im ganzen Land so und bei uns im Norden noch schlimmer. Das Problem ist die schlechte Ausbildung und der niedrige Lohn – bei den Lehrern, bei den Kulturschaffenden und bei den Angestellten der Sozialversicherungen. Das sind die drei wichtigsten, zugleich unterversorgten Bereiche, von denen die Zukunft Rußlands abhängt.“
…sawisit budusche, budusche.“
Erzähler: Ergebnis: Die bisherige russische Einheitsschule verfällt, für konsequenten, zweisprachigen Unterricht aber fehlt das Geld. Auch im Sprachprogramm der Bildungsreform zeigt sich so: Was als Reform begonnen hat, droht sich in deren Gegenteil zu verkehren. Schwache Regionen und kleine Völker werden auf sich selbst zurückgeworfen und faktisch aus einer gemeinsamen Bildungspolitik ausgegrenzt.
Der schon mehrfach erwähnte Bericht der Ruhr-Universität kommt angesichts solcher Erscheinungen zu dem Ergebnis:
Zitator: „Durch Überwälzung von Bildungsaufgaben auf die regionalen Budgets im Zeichen der Politik der Dezentralisierung wird versucht, den föderalen Haushalt zu entlasten. Eine unterschiedliche Prioritätensetzung seitens der einzelnen `Föderationssubjekte´ führt dabei aber gleichzeitig zu zunehmenden regionalen Disparitäten in der Finanzierung und damit im Gesamtzustand der Bildungseinrichtungen.“
Erzähler: Auch diese Tendenz hat sich durch den Krieg in Tschtschenien ereheblich verschärft. Dort wurden ja nicht nur die dringend benötigten Haushaltsgelder verpulvert. Dort demonstrierte die russische Regierung auch, was sie mit denen zu tun bereit ist, die die Angebote zur Autonomie zu wörtlich nehmen. Dort erleidet das Selbstbewußtsein der Bbevölkerung der russischen Föderation als einheitliche Kultur- und Bildungsnation seinen tiefsten Einbruch.
Demoralisierung, Dequalifikation und Resignation sind aber nicht die einzigen Folgen der Krise. Mächtig schlägt sich die neue Zeit auch in der Gründung neuer weiterführender Schultypen, neuer Zweige der Ausbildung und einem Boom privater Lehranstalten aller Art nieder.
Über Fünfhundert Gymnasien, ca. 350 Lyzeen wurden bereits 1992 gezählt. Das Gesetz zur Bildung legitimierte nur noch ihre Entwicklung. Inzwischen hat ihre Zahl noch einmal um fast die Hälfte zugenommen. Dazu kommen gut 7000 Schulen mit Spezialkursen, 500 private Lehranstalten und über 8000 ergänzende Anstalten, außerdem nicht erfaßbarer Hausunterricht.
O-Ton 24: Schule 10 1,02
Schulhof, Eintritt, Halle, im Gebäude…
Regie: Ton langsam kommen lassen, kurz frei stehen lassen, unterlegen verblenden
Eine besonders interessante Spielart der neuen Schulen ist die sog. Autorenschule. Viele von diesen Schulen sind nicht neu. Neu ist ihr Anspruch, das Programm in Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern und Schülern selbst zu gestalten. Eine der auch im Ausland bekannten ist die staatliche „Schule Nr. 10“ für 1500 Kinder in der Innenstadt von Nowosibirsk.
Das Schulgebäude unterscheidet sich in Nichts von dem in Ordinsk oder sonst einer beliebigen Regelschule des Landes: ein Plattenbau zwischen Plattenbauten. Allerdings sind hier in den der Hallen und Gängen ein pasar mehr Topfpflanzen aufgestellt.
Auch hier liegt die Leitung bei einer Frau, Natalja Raslawzewa. Frauen bilden die Mehrzahl des Kollegiiums. Bereitwillig geht auch Frau Raslawzewa auf alle Fragen ein:
O-Ton 25: Schule Nr. 10, Direktorin 0,33
„Ja, Direktor…“
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf am Ende hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Ich bin Direktorin der Autorenschule Nr. 10. für englische Sprache. Das ist eine der bekanntesten Schulen von Nowosibirsk, eine der ältesten; sie ist dreiundachtzig Jahre alt. Sie nennt sich Autorenschule, weil sie ein äußerst interessantes Programm hat, bei dem die Pädagogen, die Kinder und die Eltern Autoren selbstbestimmter Ausbildungsprogramme sind.“
… Natalja Raslawzewa.“
Erzähler: Auf die allgemeine Krise an den Schulen angesprochen antwortet sie:
O-Ton 26: Direktorin der Schule 10, II 1,22
„Nasche pädagogi bjedni, no ani…“
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Unsere Pädagogen sind arm, aber sie sind nicht unglücklich. Hier in der Schule fühlen sie sich wohl. Viele sagen mir: Wir rennen morgens geradezu zur Arbeit. Mag sogar sein, daß sie vor den von ihnen genannten Problemen davonlaufen.
Wir haben hier eine etwas andere Athmosphäre. Eine Athmosphäre der Güte, eine Athmosphäre des gegenseitigen Verständnisses, eine Athmosphäre, daß wir die Kinder und die Kinder uns ziehen. Wir geben einander etwas. Wir sind stolz auf unsere Abgänger. Ja, das ist ganz sicher die Elite der Stadt, wie auch des Landes! Unsere Schulabgäger sind ganz sicher gebildete Menschen und sie haben die Grundlagen, daß sie studieren oder auch direkt schon in die Berufe einsteigen können. Es ist uns nicht peinlich, wenn sie ins Ausland kommen, denn sie beherrschen alle die Sprache. Als ich zum Beispiel mit meinen Kindern nach England kam, wo ich glaubte, von ihrem Erziehungssystem lernen zu müssen, sagten mir die Engländer ganz offen: Was wollen sie nur!? Wenn wir ihre Kinder sehen, dann denken wir, daß sie das bessere System haben. Solche klugen, beschlagenen, kultivierten, nachdenklichen Kinder hätten wir auch gern. Da war ich natürlich stolz.“
…i ja gordilis.“
Erzähler: Von staatlichen Zuwendung kann aber auch die „Schule Nr. 10“ nicht leben. Die vorgegebenen Bildungsstandards reichen nicht für das angestrebte Niveau. Selbstbewußt erklärt Frau Raslawzewa:
O-Ton 27: Direktorin der Schule Nr. 10, III 0,58
„Seitschas kak prawila…“
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Heut gilt die Regel: Kommt ein Direktor, der bildet ein Kommando von Gleichgesinnten! Meine Arbeit besteht darin, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Pädagogen arbeiten können. Was vom Staat kommt, reicht nicht. Ich muß dafür sorgen, daß ihr Alltag stimmt. Zu mir kommen sie, um ihre Probleme zu lösen. Sie wissen zu genau, wieviele Versprechungen, wieviele Erlasse schon vorbeigeflossen sind. Sie glauben nur mir. Ich bin wie der Boss einer Firma. Ich bin für das Wohlergehen von 500 Menschen verantwortlich, 1400 Schüler, 150 Pädagogen, die dazugehörigen Eltern, dazu noch die Omas und Opas. Ein riesiger sozialer Komplex ist das. Ich kriege das Geld von Leuten, die uns mögen. Damit schaffe ich Möglichkeiten des Überlebens, während ich selbst übrigens genauso als Bettler lebe wie meine Kollegen.“
Erzähler: Paradox findet die Direktorin eine solche Situation. Paradox findet sie auch, daß viele Schüler über wesentlich mehr Geld verfügen als die Lehrerinnen, weil die jungen Leute aus Familien der sog. „neuen Russen“ kommen. Mit der Übersetzung von ein paar Seiten Geschäftspost oder Ähnlichem für die Eltern einer ihrer Schüler kann manche Lehrerin mehr verdienen, als sie im ganzen Monat mit dem Unterricht bekommt. Gegen solche Versuchungen hilft nur Professionalität und persönliche Lauterkeit, befindet die Direktorin.
Paradox findet Frau Raslawzewa auch, daß gerade in Zeiten wachsenden Geldmangels die schöpferische Kraft ins Ungewöhnliche wachse. Ohne Scheu spricht sie über die Sonderstellung ihrer Schule, die nicht mit der auf den Dörfern oder in den Randbezirken der Stadt vergleichbar sei. Sie sieht die soziale Differenzierung, die es vielen Kindern der Randbezirke unmöglich macht, eine solche Schule zu besuchen. Bewegt spricht sie über die Depression, die die Kinder erfaßt, wenn sie sehen müssen, wie ihre Eltern, zu denen sie früher aufblickten, heute nicht mehr zu den Vowertigen zählen: Krise der Familie, Kriminalität, Krieg in Tschtschenien – das alles möchte sie nicht bestreiten; die Diskussion darüber gehört mit zum Unterricht:
… eta bolschaja problema.“
O-Ton 28: Direktorin der „Schule Nr. 10“, IV 0,34
„No glawnie, ponimaetje…
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Aber das Wichtigste, verstehen Sie: Es gibt eine Wahl! Für Eltern, die davon überzeugt sind, daß Bildung für ihr Kind notwendig ist, gibt es die Möglichkeit, zwischen den Schulen zu wählen. Man kann sich heute entscheiden: Kaufe ich einen, sagen wir mal, Kühlschrank oder ein neues schwedisches Auto oder gebe ich mein Geld dafür aus, daß mein Kind nach dem anderen Ende der Stadt fährt, um dort eine gute Bildung zu erhalten? Allein diese Wahl ist für sich genommen schon ein riesiger Schritt vorwärts.“
…period, ponimaetje?“
Erzähler: Mit Wahlfächern, Kurssystem und der Ausrichtung auf eine verwertbare Schulausbildung ist die „Schule Nr. 10“ ganz westlich orientiert. Umso bemerkenswerter ist, daß man in
Familienfragen ausgesprochen traditionell bleibt. Die Mädchen werden in Kosmetik, Haushaltsführung, Babypflege und dergleichen, die Jungs in achtungsvollem Benehmen gegenüber Frauen, Hilfsbereitschaft und handwerklichen Fähigkeiten unterwiesen. Auch über Sexualität wird gesprochen. Aber alles erfolgt getrennt:
O-Ton 29: Direktorin der „Schule Nr. 10“, V. 1,00
„Mi chatim schenschini…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Wir wollen die Frauen weiblich und die Männer männlich machen. Es gibt ja heute so viele Irritationen. Die Schule muß da korrigieren, scheint mir. Sie darf nicht zwingen, natürlich, sie muß überzeugen. Ich denke die Mission der Frauen in der Gesellschaft ist, die Schönheit zu tragen, die Harmonie in der Beziehung zwischen den Menschen. Frauen denken oft, ihre Aufgabe bestehe darin, Männer zu übertreffen. Ich versuche meinen Mädchen beizubringen, daß es falsch ist, die Männer übertreffen zu wollen. Man muß sie korrigieren, aber korrigieren durch Sanftheit, durch Liebe, durch Milde, ihnen die Augen für die Seiten des Lebens zu öffnen, die den Mann veredeln. Meine Mädchen sollen verstehen, daß die Männer die schwere Arbeit nicht auf sich nehmen, weil sie müssen, sondern daß sie es der Frau zuliebe tun, damit sie gut miteinander leben können. Gesunde Familien sind die Voraussetzung für die Überwindung unserer Krise. Das ist sehr wichtig.“
…eta otschen waschna.“
Erzähler: Dann spricht sie von der Gefahr der „Feminisierung“ der Schule. In dieser Frage gleichen die Anschauungen der Direktorin der Eliteschule bis ins Detail denen ihrer Kollegin von der „Schule Nr. 2“ in Ordinsk auf dem Lande.
Zwei weitere staatliche Schulen dieser Qualität gibt es in Nowosibirsk, die „Schule Nr. 42“ und die „Schule Nr. 48“. Sie sind weniger auf westliche Standards eingerichtet, achten mehr auf Vermittlung russischer Traditionen. In einem aber sind die drei absolut gleich: Wer diese Schulen absolviert hat, hat keine Probleme, eine qualifizierte Arbeitsstelle, einen Stidienplatz oder auch einen Aufenthalt im Ausland zu erhalten.
Vergleichbar sind sie auch noch in einem weiteren Punkt: als staatliche Schulen sind sie zwar unentgeltlich, sind wie jede staatliche Schule ebenfalls verpflichtet, Kinder aus dem umgebenden Bezirk kostenlos aufzunehmen. Die Wirklichkeit ist jedoch anders. Tanja, Mutter einer sechsjährigen Tochter, die vor der Frage steht, wo sie ihre Kleine einschulen soll, schildert, wie eine Einschulung dort vor sich geht:
O-Ton 30: 1,23
„Jest, konjeschna, sapis po…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzerin hochziehen, danach abblenden)
Übersetzerin: „Es gibt die Aufnahme per Bezirk, natürlich, dann Prüfungen, Beziehungen. Einige schaffen es so, aber letztenendes laufen die meisten Aufnahmen doch über Geld, in letzter Zeit nur über Geld. Man schaut sich die Eltern an. Wenn die Eltern, wie es heißt, der Schule helfen können, entweder mit einer einmaligen Aktion oder dauernd, dann wird das Kind aufgenommen. Die einen geben persönlich Geld, die anderen unterstützen die Schule mit ihrer Firma. Oder man bringt der Schule etwas – nicht Bargeld, sondern einen Fernseher, einen Computer, einen Kopierer. Der Preis entspricht ungefähr einem Computer, das sind 1000 bis 2000 Dollar allein für die Aufnahme.“
… sa pristuplennije.“
Erzähler: 100 Dollar ist das Spitzengehalt für Lehrpersonal. Tanja als freischaffende Psychotherapeutin verdient mehr. Aber auch sie hat Mühe, das Geld aufzubringen. Trotzdem kommt die Schule ihres Bezirkes für Tanja nicht in Frage. Sie befürchtet, daß ihre Tochter dort nicht nur nicht gefördert, sondern mit Wissen von gestern vollgestopft, behindert und verstört wird. Die neuen privaten Schulen sind ebenfalls keine Alternative. Sie fordern noch mehr als die guten staatlichen Schulen, aber ihr Erfolg ist ungewiß. Viele schließen schon nach kurzer Zeit wieder, andere werden nicht anerkannt. Kinder aber, die auf Privatschulen waren, werden von Staatsschulen nicht wieder aufgenommen. Sie gelten als pädagogische Problemfälle.
Die Freiheit der Wahl, von der die Direktorin der „Schule Nr. 10“ so hoffnungsvoll sprach, erweist sich unter solchen Umständen eher als Zwang: Bildung ist zur Voraussetzung des Überlebens geworden, die man seinen Kindern, notfalls unter Einbeziehung der gesamten Verwandtschaft, unter allen Umständen zu ermöglichen sucht.
Die jungen Leute sind sich dieser Tatsache bewußt. Schülerinnen der „Schule Nr. 10“ etwa, auf ihre priveligierte Situation angesprochen, antworten nach kurzer Verlegenheit übereinstimmend::
O-Ton 31: Schülerinnen der „Schule Nr. 10“ 0,59
Lachen, „ja nje snaju. Njet mi…“
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Erzähler hochziehen
Erzähler: „Wir haben uns schon daran gewöhnt.“ „Das Bildungsniveau ist erheblich höher.“ „Unsere Lehrerinnen sind einfach Spitze, Elite eben, sie verstehen es, mit den Kindern umzugehen und sie geben einen sehr guten Unterricht.“
An ihrer Schule herrsche ein anderer Ton, finden sie, nicht mehr der totalitäre Unterricht von früher wie noch an den meisten andeen Schulen, sondern kameradschaftlicher Umgang zwischen Lehrerinnen und Schülern. „Wir sind hier eine Gemeinschaft“, meint ein Mädchen, „auch die Eltern kennen sich lange, ohne Beziehungen kommt hier keiner rein.“
Von privaten Schulen halten sie wenig. „Was sagt schon ein Firmennamen wie `Ramoschka´ oder so“, erklärt eine andere, „der öffnet doch keine Universität. Leute von der zehnten Schule dagegen nehmen sie überall mit Vergügen, weil du eben an einer guten Schule gewesen bist, die ihr Image hat.“
…otlitsche drugich schol.“
Den Kindern ist eine solche Ausbildung zu gönnen. Zu gönnen sind ihnen auch die neuen Gymnasien und Lyzeen, wo es ähnlich zugeht. Auch Ergänzungsschulen nach der Art der „Theaterschule Smile“, ebenfalls Nowosibirsk, sind begrüßenswerte Erscheiunungen. Bei „Smile“ treffen sich Kinder aller Schulen der Stadt zu einer künstlerisch orientierten Zusatzausbildung. Pädagogisches Ziel ist die allseitige Entwicklung der Persönlichkeit.
Initiativen dieser Art gibt es inzwischen in allen größeren Städten. Dazu kommen private Angebote zur Weiterbildung an „freien Universitäten“. In lockerer Form, die wissenschaftliche Forschung und Identitätssuche verbindet, werden Arbeitsseminare, workshops, ganze Ausbildungszüge zu den verschiedensten brennenden Themen ergänzend zum offiziellen Wissenschaftsbetrieb angeboten. Initiatoren sind nicht selten Hochschullehrer und -lehrerinnen, die sich auf diese Weise zugleich ihren Lebensunterhalt verdienen.
Dies alles ist erfreulich – aber es kostet in der Regel mehr, als durchschnittlich verdienende Familien aufbringen können. Unter diesen Umständen wird die Bildungskrise zur sozialen Krise, ja, sie verschärft den sozialen Druck, indem die von den jetzigen Veränderungen wirtschaftlich ohnehin schon Abgedrängten, nun auch noch von der Ausbildung ausschließt.
Entgegen den erklärten Absichten der Reformer ist Bildung daher auf dem Wege, von einem allgemeinen Recht, dessen Wahrnehmung der Staat garantiert, zum Vorrecht derer zu werden, die es sich leisten können.
Gut fünf Prozent der russischen Bevölkerung, alte Nomenklatura und neue Reiche, so rechnen Ethnologen der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften vor, können ihren Kindern problemlos die neuen Bildungschancen, einschließlich Studium im Ausland, eröffnen. Weitere zehn bis 15 Prozent eines neuen Mittelstandes, vor allem aus dem Dienstleistungsbereich, schaffen es mit Mühe. Das gelingt häufig nur unter Einsatz der gesamten Familie, einschließlich der Verwandten und Großeltern, die zusammenlegen, um dem Enkel, in zweiter Linie auch der Enkelin, die Ausbildung zu ermöglichen.
O-Ton 32: Ethnologen in St. Petersburg 0,42
„Drugaja tschast, ona destwitelna…“
Regie: Ton kurz stehenlassen, abblenden
(bei Bedarf nach Übersetzer hochziehen, danach abblenden)
Übersetzer: „Beim übrigen Teil der Jugendlichen zeigen sich befremdliche Dinge: Hang zu Hordenbildung, Zusammenrottung in bewaffneten Gefolgschaften, politischer Extremismus. Das betrifft vor allem die 25- – bis 29-jährigen. Bei Beginn der Perestroika waren sie in dem Alter, in dem man sein Ich entdeckt, seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Sie sind junge Leute, sie wollen einen Platz. Aber die Gesellschaft gibt ihnen keinen. Die RNE des Barkashows gibt ihnen diesen Platz.“
…nje istwestno schto.“
Erzähler: Die „RNE Barkaschows“, das ist die „Russische nationale Einheit“, eine militante Bewegung mit erklärter nationalistischer Zielsetzung. Ihr Führer Barkaschow erklärt offen seine Symphatie für Hitler.
1993 war es die „RNE“, die die militantesten Kämpfer zur Verteidigung des „weißen Hauses“ stellte. Sie standen dort Seite an Seite mit Altkommunisten. „350 Stützpunkte der RNE sind bekannt. In Moskau, St. Petersburg, auch in Industriestädten des Ural oder Sibiriens zählen die Mitglieder nach Tausenden. In kleineren Städten sind es manchmal nur ein oder zwei Leute. Arbeitslosen Jugendlichen verschafft die „RNE“ Beschäftigung im Werk- oder Personenschutz. In ländlichen Gebieten kommt es vor, daß „RNE“-Kommandos maskiert die Auszahlung der Lohngelder von den Direktoren fordern und an die Arbeiter verteilen. Barkaschow pflegt für sich erfolgreich das Image eines russischen Robin Hood. In den Wehrkreisen und Sommerlagern der „RNE“ lebt die Tradition der Pioniere auf. Hier finden die Jugendlichen eine Heimat und entwickeln ein neues Selbstbewußtsein als „Soldaten Rußlands“.
Ähnliches gilt übrigens für Wladimir Schirinowskis Partei – nur daß er sich mehr an die Älteren wendet, die aus bereits erreichten Positionen verdrängt werden.
Noch sind es wenige, die den Weg in solche radikalen Strukturen finden. Die große Mehrheit der Ausgegrenzten bleibt bisher apathisch. Wenn das extreme Auseinanderdriften einer sozial und kulturell privilegierten Elite und einer zunehmend dequalifizierten Mehrheit aber nicht bald gestoppt, mindestens jedoch gemildert wird, bevor noch eine weitere Generation durch die Schulen gegangen ist, dann ist nicht auszuschließen, daß viele, vor allem junge Menschen, ihre Zukunft nicht in der Vielfalt, sondern in den Versprechungen auf eine gewaltsame Wiederherstellung der verlorenen Einheit suchen.