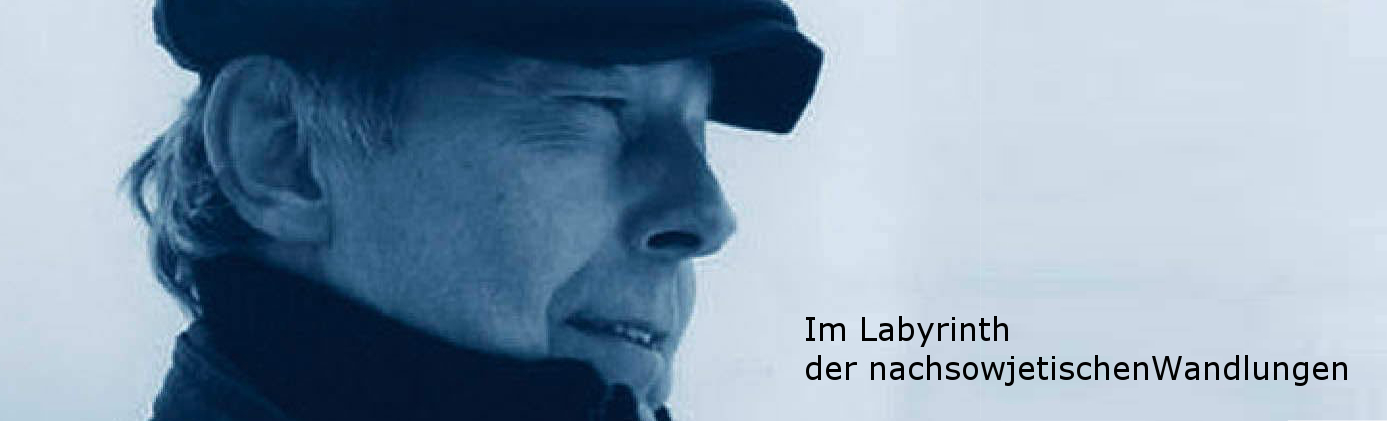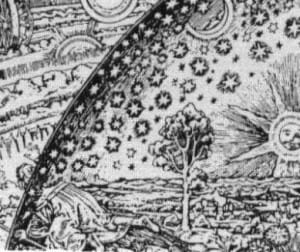Vortext:
Erneuerung der Führungsstrukturen, Schaffung eines selbstständigen Mittelstandes und Anhebung des allgemeinen Konsumniveuas auf westliche Standards war das Ziel der als Perestroika bekanntgewordenen sowjetischen, später russichen Reformen. Eine Modernisierung für das kommende Jahrtausend sollte es werden. Anfang 1997, nach seiner Bestätigung als Präsident, kündigte Boris Jelzin eine zweite Reformwelle an. Sie werde, versprach er, den wilden Kapitalismus durch einen zivilisierten ablösen. Nur ein Jahr später tauschte er die gesamte Regierung aus – mit derselben Begründung.
Was geht in Rußland vor? Unser Autor Kai Ehlers berichtet.
O-Ton 1: Metro, Straßenagitation 1,20
Regie: Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen
Erzähler:
Moskau. Immer noch Zentrum der politischen Macht in Rußland. Im Rednereck auf dem Platz der Revolution agitieren Ultralinke gegen die „kommunistische Partei Rußlands“. Kompromißlertrum wirft man ihr vor, Beteiligung am Ausverkauf des Landes, Klassenverrat. Werte aus der Zeit werden beschworen, als die kommunistische Partei noch die einzige politische Kraft war. Vergeblich: Die Partei der alten Nomenklatura gibt es nicht mehr. Vielfalt ist anstelle des früheren Machtmonopols getreten. Auch die direkten Erben der alten Staatspartei haben sich in mehr als ein Dutzend Nachfolger gespalten. Die „Kommunistische Partei Rußlands“, mit rund zwanzig Millionen Mitgliedern die größte unter ihnen, ist zugleich die größte Partei im Lande. Umstürzlerische Töne sind von ihr jedoch kaum noch zu vernehmen. Was ist geschehen?
Iossif Diskin, Soziologe am Institut für regionale Volkswirtschaft, nach eigenen Aussagen Spezialist für Transformation und darüberhinaus Eliteforscher, glaubt eine Erklärung zu haben:
O-Ton 2: Iossif Diskin 1,20
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer (bei 0,20) vorübergehend hochziehen, wieder abblenden, unterlegen, nach Erzähler hochziehen
Übersetzer:
Schto presaschlo? Na moi wsglad…
„Was geschehen ist? Meiner Ansicht nach verwandelte die Kommunistische Partei sich in einen Teil des russischen Establishments. Sie ist nicht mehr an grundlegenden Veränderungen interessiert. Sie ist einfach zu einer starken Opposition geworden.“
Regie: vorübergehend hochziehen
… stala Opposizii uwelitschii.
Erzähler:
Die Fakten sprechen für Diskins Sicht: 1994 stimmte die Kommunistische Partei Rußlands der Verfassung zu, danach dem von Boris Jelzin ausgerufenen Burgfrieden; ihre Mitglieder sind in allen regionalen Verwaltungen aktive Träger der offiziellen Politik. Die soziale Rolle der Partei hat sich verändert: 1991, nach ihrem Verbot, war sie marginalisiert; seit den Wahlen, die sie als stärkste Kraft der Opposition auswies, ist sie wieder attraktiv. Sie bietet Zugänge zum gesamten Verwaltungsapparat Rußlands auf allen Ebenen. Damit finden auch junge Leute dort wieder Aufstiegsmöglichkeiten.
„So funktionieren doch linke Parteien in ganz Europa!“, wehrt Diskin Zweifel in die Glaubwürdigkeit der Partei ab: Mit einer Hand beteilige man sich an der Macht, mit der anderen führe man politische Meetings durch; in diesem Sinne, setzt er ganz ohne Ironie nach, baue sich im heutigen Rußland ein westliches politisches System auf.
..sapadni polititschni system.
Erzähler:
Der anderen, der regierenden Seite dieses von Diskin so genannten westlichen Systems kann man nur wenige Schritte vom Platz der Revolution entfernt im Büro Jefgeni Proschtschetschins etwa begegnen. Jefgenei ist einer der 33 Abgeordneten der Moskauer Stadtduma. Vor der Wende 1991 arbeitete er als Heizer in einem der Moskauer Hochhauskeller. Das war seinerzeit einer der typischen Berufe für kritische Intellektuelle. Der Keller diente auch als Anlaufpunkt für das dort entstehende „Antifaschistische Moskauer Zentrum“. Als dessen Chef wurde Jefgeni nach der gewaltsamen Auflösung der Sowjets durch Boris Jelzin 1993 in den Moskauer Stadtsowjet gewählt. Dort übernahm er die „Kommission für nationale Fragen und Extremismus“. Ein Jahr später zog er aus dem Ein-Zimmer-Loch, in dem er mit Frau und Kind gehaust hatte, in eine neue, komfortable Drei-Zimmer-Wohnung.
Im Büro herrscht hektische Aktivität. Neben dem Abgeordneten selbst befinden sich noch weitere fünf Personen in dem Raum, die dort vier Telefone, FAX, Computer, dazu noch mehrere Mobiltelefone bedienen. Jefgeni erklärt seine Arbeit; zu den Führungsstrukturen des Staates befragt, antwortet er:
O-Ton 3: Jefgeni Proschtschetschin 0,50
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Tut nektorie njepominannije…
„Hier gibt es einige Unklarheiten: Ob liberaler, ob sogenannter liberal-demokratischer Staat! – In Rußland ist es vollkommen unmöglich, vom Staat als einem Ganzen zu sprechen. Das sind zwanzig, dreißig verschiedene Richtungen. Allein schon Moskau! Da sind die Bezirke, da sind Subpräfekturen mit eigenen Stabsquartieren. Ist das die Macht? Das ist die Macht! Die kontrolliert niemand. Bei uns in Rußland herrscht zur Zeit solch ein Chaos! Zu denken, daß es da irgendwelche Strukturen gäbe, die direkt vom Präsidenten zu irgendeinem Dorf gingen, nein!“
…passiolka, njet.
Erzähler:
Seinen eigenen Platz als Abgeordneter in diesem Chaos beschreibt Jefgeni mit einem Ausflug in die Physik:
O-Ton 4: Jefgeni Proschtschetschin, Forts. 1,11
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Wy snaetje, we Rossije…
„Wissen Sie, in Rußland treffen wir heute auf das, worauf die Physik stieß, als sie vom Makrokosmos auf den Mikrokosmos vordrang. Dort gelten schon andere Gesetze als die Newtons. Wo befindet sich das Elektron? fragten die Physiker damals. Aber wer die Quantenmechanik auch nur ein wenig kennt, der weiß, daß die Frage einfach nicht korrekt gestellt war. Es ist eben nicht klar, wo das Teilchen sich befindet; unklar ist auch, was Wirklichkeit und was Möglichkeit ist; man kann es nicht sagen! Genausowenig weiß ich, wo ich mich befinde. Im tschetschenischen Krieg war ich in der Opposition; jetzt ist Boris Nemzow Vizepremier, da bin ich für ihn. Wo ich morgen stehe, weiß ich nicht. Wir hängen weiter zwischen Himmel und Erde. Wir ähneln den Alpinisten, die abstürzen und von denen einer zum andern sagt: `Was denn, das soll das Ende sein? Hände und Füße sind doch noch ganz; wir fliegen ja noch!´“
… my jeschtscho letim.
Erzähler:
Man müsse weiter beobachten wie seinerzeit Niels Bohr, fährt der Abgeordnete fort, müsse sich selbst als Teil des Experiments begreifen, dessen Fortgang durch eigene Aktivitäten zu beeinflussen suchen. Nur Schritt für Schritt könne man heute in Rußland in Richtung rechststaatlicher Strukturen vorankommen.
Teil des von Jefgeni beschriebenen Experiments ist offenbar auch eine attraktive junge Frau, die sich ebenfalls in dem Büro aufhält. Sie fällt zunächst nur dadurch auf, daß sie rundherum freundlich Tee einschenkt, Gebäck reicht, im Hintergrund telefoniert und mit den Anwesenden schwatzt. Sie scheint selbst Gast zu sein. Sekretärin ist sie jedenfalls nicht; Sekretärin ist Olga, die den Computer bedient. Aber niemand kümmert sich besonders um die Unbekannte. Direkt befragt, erweist sich ihre Identität als im höchsten Maße erstaunlich:
O-Ton 5: Vera 0,50
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Erzähler hochziehen
Übersetzerin:
Menja sawut Vera…
„Ich heiße Vera, ich bin Managerin. Ich bin noch Studentin, aber gerade im Abschlußsemester. Ich habe fünf Jahre an der Moskauer humanistischen Universität studiert. Ich schreibe soeben mein Diplom. Da ich Zeit über habe, kann ich noch arbeiten.“
Erzähler:
Vera ist in einer Baugesellschaft tätig. Im Büro der Duma sucht sie praktische Erfahrung. Sie gehe in dieses Busyness nur hinein, sagt sie, um Nuancen kennenzulernen, Beziehungen herzustellen, Verhandlungen anzubahnen, Treffen einzuleiten.
…delawoi stretschi, Bürogeräusche.
Erzähler:
Dem Erstaunen, was sie als Managerin eines Baugeschäftes in einem Büro der Stadtduma zu tun habe, begegnet sie mit der entwaffnenden Erklärung:
O-Ton 6: Vera, Forts. 0,29
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzerin hochziehen.
Übersetzerin:
Nu, potamutschta…
„Nun, weil das in unserem Lande so – (lacht) – das Passende ist. Hier im Büro kann man legal tätig sein. Hier kann man sich mit dem großen Geschäft befassen. Das ist ja äußerst schwierig. Firmen, die eben erst anfangen, die gerade ein Büro aufmachen wollen, wie die unsere, müssen ja immer darauf achten, daß sie gut angesehen sind, vor allem in der kriminellen Welt – in diesem Gebäude gibt es diese Welt nicht.“
… eta sdannje nje nachoditsja.
Erzähler:
Ruhige Arbeit, Verbindungen, Beziehungen zu Amtsstellen, das alles suchen Vera und ihre Auftraggeber in diesem Büro. Beziehungen seien schon immer wichtig gewesen, erklärt Vera. Aber heute könne ein junger Mensch und auch eine Firma ohne Verbindungen überhaupt nicht mehr existieren. Eine allgemeine Struktur kann Vera in dieser Art der parlamentarischen Büroorganisation aber nicht erkennen. Heftig wehrt sie derartige Vermutungen ab:
O-Ton 7: Vera, Forts. 0,32
Regie: Ton stehen lasssen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzerin hochziehen
Übersetzerin:
Njet, njet, eta…
„Nein, nein, das ist zufällig. Kann sein, daß es das woanders auch gibt. Aber das kommt einfach daher, daß man gute, freundschaftliche Verbindungen hat. Es sind rein persönliche Verbindungen, rein persönliche Interessen. Man kennt sich lange und versucht sich gegenseitig weiterzuhelfen. Aber ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen darf.“
..ne snaju, lacht
Erzähler:
Dabei bleibt es. Einzelheiten mag Vera, aller Liebenswürdigkeit zum Trotz, nicht mitteilen. Weitere Elemente des Freundschaftsgeflechtes läßt jedoch ein Besuch in der Wohnung des Abgeordneten erahnen: Zu Gast ist an diesem Tage auch Sergei, ein recht beleibter und unter den Anstrengungen des Essens schwitzender leutseliger Mann mittleren Alters. Sergei ist Mitarbeiter in dem eigens vom Präsidenten geschaffenen Kontrollapparat, dem die Überprüfung der präsidialen Erlasse im Lande obliegt. Gefragt, wofür eine solche Kontrolle nötig sei, wenn es doch schon die Administration, die föderativen-, die Landes und die Ortsparlamente gebe, dazu noch die allgemeine Rechtsaufsicht, Prokura genannt, die Staatsanwaltschaft und die Polizei, schließlich noch den Geheimdienst des Innenministeriums als Nachfolger des KGB, antwortet Sergei:
O-Ton 8: Sergei, Kontrolleur 1,10.
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Erzähler kurz hochziehen, abblenden
Übersetzer:
Nu, potamuschta u nas…
„Nun, weil es bei uns, bei der Mehrheit der Menschen keine automatische Erfüllung der Gesetze gibt. Schon Lenin sagte ja, Sozialismus ohne Kontrolle kann es nicht geben. Heute ist es nicht anders: Solange wir noch in dem Zustand sind, einen Rechtsstaat zwar zu wollen, ihn aber noch keineswegs haben, brauchen wir diese Kontrolle.“
Erzähler:
Als Organ der Führungskontrolle soll Sergeis Amt im Hintergrund wirken, die juristische Abwicklung der Fälle dagegen den öffentlichen Stellen überlassen; faktisch müßten sie deren Tätigkeit jedoch noch mit überwachen, klagt Sergei.
… do konza
Erzähler:
Die Privatisierung hat all die feinen Unterscheidungen zwischen `öffentlich´ und `nichtöffentlich´ hinfällig werden lassen, klagt Sergei. Daß er selbst Teil des Filzes ist, sieht er nicht. Die informelle Hilfe, die sich die Büros der Dumas und jene der Verwaltungen über Amts-, Partei- und Ortsgrenzen, ja, sogar über die politischen Flügel hinweg leisten, irritiert ihn in keiner Weise. Anders könne man heute in Rußland nicht arbeiten; da ist auch Jefgeni mit ihm ganz einer Meinung.
O-Ton 9: Metro, Gesang 0,15
Regie: Allmählich hochziehen, kurz frei stehen lassen, allmählich abblenden
Erzähler:
Die Karriereleiter der kommunistischen Partei, die Bürofreundschaften der Stadtduma repräsentieren nur Ausschnitte der neuen russischen Wirklichkeit. Auf der Suche nach dem ganzen Bild stoßen wir auf Jefim Berschin und Kyrill Swetitschki. Beide sind Redakteure der „Literaturnaja Gaseta“ in Moskau. Als Berichterstatter in Grosny waren sie intime Beobachter des tschetschenischen Krieges und enge Gesprächspartner Alexander Lebeds, des Generals, der den Krieg schließlich beendete und der im anschließenden Präsidentenwahlkampf 1996 zum großen Saubermachen aufrief. In Grosny hatten Jefim und Kyrill Gelegenheit, das ganze Ausmaß der Verfilzungen ihres Landes kennenzulernen.
Allem voran, so die beiden, sei nach den Ergebnissen der großen Umverteilung, der Privatisierung des Partei- und Volksvermögens zu fragen. Nur so lasse sich erkennen, wer jetzt im Lande die Kommandogewalt habe:
O-Ton 10: Jefim Berschin, Kyrill Swetitschki 0,56
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, allmählich abblenden
Übersetzer:
Na samom delje Sowjetskom Sojuse…
„Im Wesen war die Sowjetunion ja so aufgebaut, daß die Partei das Geld hatte. Aber das große Geld lag natürlich nicht irgendwie herum, es war den Strukturen zugeschrieben – durch bestimmte Betriebe, durch Erholungsanlagen, durch soziale Versorgungseinrichtungen usw., die zur Partei, vor allem aber auch zum Komsomol, ihrer Jugendorganisation gehörten. Als die Privatisierung begann, mußte man sich nur nehmen, was man schon hatte.“
Erzähler:
Im Grunde seien all die neuen Besitzer kriminell, befindet Kyrill, denn die Formierung der neuen Klasse, genauer, die Neuformierung der alten rund um das Geld, habe da begonnen, wo das Volk mit undurchsichtigen Methoden enteignet worden sei. Letztlich sei alles nur eine Frage des Daches erklärt Jefim:
O-Ton 11: Jefim, Forts. 0,23
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Kryscha, eta to….
„Ein Dach, Kryscha, ist das, was dich beschützt. Der Schutz wird heute von kriminellen Banden gestellt. Privatunternehmer können heute ohne solche Beschützer nicht überleben.
…bes akrana ti ne vysawisch
Erzähler:
Das gelte sogar für die früheren Komsomolzen. Sie hätten ja früher nicht nur über die Vermögen verfügt, sondern auch besondere Verbindungen zum KGB und zu Spezialdiensten gehabt. Deshalb werde ihr Dach heute vornemlich aus diesen alten Kreisen des Staatssicherheitsdienstes gestellt. Steuergesetze, Zoll – das seien für sie alles keine Probleme. Sie hätten überall ihre Leute. Aber auch für sie seien die Kämpfe in den ersten Jahren brutal gewesen:
O-Ton 12: Berschin, Forts. 0,39
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Perwie Moment…
„Anfangs wurde jeden Tag erschossen, gemordet, irgendjemand aufgehängt. Es ging um die Aufteilung der Einflußsphären. Jetzt ist das schon nicht mehr so. Jetzt hat man sich schon irgendwie miteinander arrangiert. Im Kern wird heute nicht mehr auf dem Niveau von Banditen mit Pistolen entschieden, sondern auf der Ebene großer Leute, einschließlich der Regierung. Man trifft sich im Restaurant, unter großen Mafiosi; man nimmt sich eine Flasche guten Spirit und redet miteinander.“
…i dogawariwatsja.
Erzähler:
Diese Leute hätten vor nichts mehr Angst, so Jefim weiter, anders als die frühere Nomenklatura, die die Kontrolle der Partei befürchten mußte. Auch die Presse sei ihnen gleichgültig; die meisten Zeitungen gehörten inzwischen ohnehin dem einen oder anderen Clan. Das einzige, was noch Wirkung zeige, seien Kompromate, kompromittierende Informationen. Aber auch sie tauchten nur kurfristig in den Medien auf, um politische Änderungen zu erzwingen; danach seien sie schnell vergessen:
O-Ton 13: Kyrill, Forts. 0,26
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Eta proischodit tak…
„Das geht so: Iwan Iwanow klaut am Kiosk fünf Flaschen Wodka. Das Kompromat verkündet nun, daß Iwanow eine Flasche Wodka klaute. Iwanow weiß, daß es fünf Flaschen waren und er weiß auch, daß der Präsident es ebenfalls weiß. Also macht er sich ruhig davon, sonst könnte es geschehen, daß auch die anderen vier Flaschen noch erwähnt werden…“
…(lachen)
Erzähler:
Die Orgnanisation der Dächer ist streng geregelt. Es gibt offizielle Bewachungsfirmen mit großem Einfluß. In ihnen sind vor allem die früheren Spezialdienste tätig. Daneben existieren die mafiotischen, rein kriminellen Formen. Auch sie haben eine feste Struktur: Da gibt es eine Leitung – das sind die Leute, die irgendwie im Geschäft sind, und es gibt die unten – sie werden „Byki“, Bullen genannt. Sie haben nichts zu sagen, erfüllen Lohnaufträge. Dazu kommen Verbindungen zur Bürokratie, der man bestimmte Gelder zahlt:
O-Ton 14: Berschin, Forts. 1,14
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Jesli ti atkriwaesch…
„Wenn Du eine Firma eröffnest, kommen sie von selbst. Auch wenn da nichts Geschriebenes ist, kommen sie. Sie wissen so oder so bescheid. Da kommen dann Leute zu dir, so nette Leute, im Schlips und mit intelligenten Umgangsformen. Lieber Iwan, sagen sie zu dir, wir möchten gern mit dir zusammenarbeiten. Wir schließen mit dir folgenden Vertrag für den Bezirk, in dem wir arbeiten: Du arbeitest ruhig, bezahlst uns 10%, möglicherweise 20, dann bist du sicher, dann wird dich niemand anfassen. – Daneben gibt es noch die andere Variante: Da fordert man keine Prozente, du mußt auch nichts für sie erledigen, da geht es nur noch um schwarzes Geld. Sie sagen dir: `Iwan, du hast ein Konto, hier nimm unser Geld, damit es gemeinsam in den Kreislauf kommt.´ Und die Prozente, die dir nicht gehören, die nehmen sie für sich. In diesem Fall nützt das allen. Sie nehmen keine Kopeke von dir, sie verschaffen dir Sicherheit und Euer Geld arbeitet gemeinsam. Es gibt also unterschiedliche Mechanismen.“
…raslitschni mechanismi
Erzähler:
Die großen Geldleute, erklärt Jefim, sind heute interessiert daran, die zusammengerafften Gelder zu legalisieren. Dafür brauchen sie Dokumente, legale Genehmigungen, legale Konten, Lizensen, Registrierungen usw. Wer glaubt ohne sie auszukommen, wird kaltgestellt. „Aber inzwischen“, so Jefim, „gehen sie zum Bürgermeister, wo man die Lizensen für die Geschäfte ausgibt, und schwupp, gibt es keine Lizens mehr.“ So wie es dem Benzin-König von Moskau ergangen sei:
O-Ton 15: Jefim, Forts. 0,49
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Menja prosta posnakomja odin…
„Ich kenne ihn; er hatte alle Tankstellen unter sich. Er ist ein kluger, wohlerzogener Bursche, ehemaliger Komsomloliz, sehr jung noch, hat da ehrlich im Komsomol gearbeitet, dann im Busyness, na, eben auf diesem üblichen Weg. Er hatte ein Dach, natürlich. Dann begann er ziemlich eigenständig aufzutreten. Als der Krieg in Tschetschenien begann, weigerte er sich, Steuern zu zahlen, um den Krieg nicht zu unterstützen. Er bot Tschernomyrdin riesige Geldsummen an, wenn bloß der Krieg aufhöre; er weigerte sich, Geld für den Bau der Erlöserkriche in Moskau zu geben. Ergebnis: Am Ende des Jahres lief seine Lizenz für die Tankstellen ab – eine neue hat er nicht bekommen. Das war´s dann. Er ist einmal Benzin-König gewesen.“
…benzinom Karolom
Erzähler:
Methoden wie im Westen, spöttelt Jefim. Kyrill ist skeptisch: Rußland ist nicht der Westen, findet er. Im Westen seien die Verhältnisse seinerzeit völlig andere gewesen. Da habe es einen starken Staat, Imperatoren, Monarchen, Landesherrn und soziale Schichten gegeben, die den Prozess der Kapitalisierung insgesamt trugen. Mit ihnen konnte die kriminelle Welt nicht konkurrieren. Rußland habe dagegen heute eine schwache Regierung, doch eine starke kriminelle Struktur:
O-Ton 16: Jefim, Forts. 0,33
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen
Übersetzer:
Jest sakoni zoni…
„Die Sache ist die: Rußland hat seine Tradition der Zonen, der Lager, der Verbannung; die ist schon sehr alt. Das sind bisweilen ganze Landstriche. Sie haben ihre eigenen Gesetze. In der Stalinzeit, als zeitweilig 50 Millionen Menschen in den Zonen lebten, jetzt Gulags genannt, entwickelten die Zonen sich zur Gegenwelt des Staates. Sie umfaßte nicht nur Kriminelle, sondern aller Gegner der Sowjetmacht oder solche, die dazu erklärt wurden. Im Zuge der Liberalisierung ist der Staat schwächer geworden. Das begann gleich nach dem Tode Stalins; mit Gorbatschow hat es sich nur fortgesetzt. Jetzt ist die Mauer gegenüber der Zone ganz eingebrochen. Dabei ist das Gesetz des Staates aber nicht zu dem der Zone, sondern das der Zone zu dem des Staates geworden, weil die Zone wesentlich organisierter ist als der Staat, weil sie wesentlich stärkere Gesetze hat. Sie sind nicht einmal geschrieben, sie wirken nur einfach in den Köpfen der Menschen. Heute herrschen im Geschäftsleben, in dem, was allgemein Demokratie genannt wird, und was Kohl und Clinton so sorgsam unterstützen, die Gesetze der Zone. Wir leben im Lager!“
… schiwjom Lagerje
Erzähler:
Eine ganze Gesellschaft im Lager? Doch, doch! beharrt Jefim.
Am Besten begreife man es an dem, was in der Sowjetzeit, aber auch im heutigen Rußland mit einem Zonenausdruck „Obschag“ genannt werde, was soviel wie Gegengemeinschaft bedeute. .
O-Ton 17: Jefim, Forts. 1,06
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende kurz hochziehen
Übersetzer:
Obschag, ransche…
„`Obschag´ – Das ist so: Zur Zeit der Sowjetmacht gab es die sogenannte `Kasse´. Nehmen wir an, wir haben zusammen geklaut; dann hat man dich geschnappt und du sitzt im Lager; mich haben sie aber nicht geschnappt. Was mache ich? Ich nehme einen Teil des Geldes, das wir gemeinsam geklaut haben, ich benutze es, um deine Familie zu ernähren, deine Kinder, dir Freßpakete ins Lager zu schicken. Allmählich hat sich aus solchen Aktionen eine ganze Organisation entwickelt, Leute, von denen schon nicht mehr allein ein Mensch abhängt, sondern schlicht die ganze kriminelle Welt. Sie bestimmen die Summen, die zu zahlen sind, sammeln das Geld ein und von diesen Geldern werden die Familien derer unterstützt, die im Gefängnis sitzen oder im Lager leben usw.usw.“
…i tagdali, tagdali.
Erzähler:
In der sowjetischen Zeit waren diejenigen, die aus dem Lager kamen, praktisch vogelfrei! Sie bekamen keine Papiere, ohne Papiere bekamen sie keine Arbeit, ohne Arbeit kein Zuhause. Mit dem Geld der „Obschag“ wurde ihnen ein Überleben ermöglicht. Man kaufte eine Wohnung, man kaufte Bürokraten, um die nötigen Unterschriften unter die Dokumente zu besorgen. So wurde „Obschag“ ein ganzes System. Es gab Leiter, „Derschateli“ genannt, die „Halter“. Das waren diejenigen, welche die Kasse verwalteten. „In neuerer Zeit“, so Jefim, „ist `Obschag´ ins Geschäfstleben übergegangen; es war einfach nicht mehr sinnvoll, das Geld nur in Kassen zu halten und dann daraus einzusetzen. Heute gilt: Wenn Geld vorhanden ist, muß es kreisen, und das heißt: Geschäft!“
O-Ton 18: Jefim, Forts. 0,48
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
To est, Tschast sowodnischewa…
„Ein Teil des Geldes im heutigen Geschäftsleben Rußlands ist deshalb Geld aus der `Obschag´. Und hier herrscht natürlich eine harte Disziplin. Wenn du dich nicht beugst, wirst du bestraft, ganz zu schweigen davon, daß dir schon niemand mehr hilft. Das bedeutet, die Gesetze dieser Lagerbrüderschaft, die jeder kennt, der irgendeine Beziehung dazu hat, ohne das sie aufgeschrieben werden müßten, werden von niemanden übertreten. Und letztlich sind alle diese Gesetze faktisch auf den Staat übergegangen.“
…faktitschiski gossudarstwa.
Erzähler:
Das gilt sogar für die Sprache, meint Kyrill. So heiße Boris Jelzin bei vielen Menschen heute „Pachan“. Das bedeute so viel wie Chef und sei der Zonenausdruck für Papa. Auch in den Zeitungen, im Fernsehen, in den staatlichen Strukturen tauchten mehr und mehr Zonenausdrücke auf. Die Hauptaufgabe der Juristen der Zone, so Jefim, bestehe heute darin, keine Gesetze durchzulassen, welche die der Zone durchkreuzten. Deshalb unterhalte die Zone eine ziemlich starke Lobby in der Duma. Sie finanziere die Wahl von Delegierten, sie kaufe Entscheidungen, indem sie Abgeordnete besteche. Das laufe alles auf hohem Niveau. Selbst ein neuer Stalin könne diese Verhältnisse heut schon nicht mehr ändern. Es fehlten die entsprechenden staatlichen Strukturen. Der tschetschenische Krieg habe gezeigt, was von den Staatsorganen heute zu halten sei. Um die Gesellschaft von den Gesetzen der Zone zu befreien gebe es heute nur zwei Wege:
O-Ton 19: Jefim, Forts. 0,58
Regie: Ton stehen lassenm, abblenden, unterlegen
Übersetzer:
Putj pervi…
„Der Erste Weg: Die ganze Bevölkerung Rußlands aus diesem Staat zu vertreiben. Aber wohin? Der zweite: Warten, bis sich die Gesetze der Zone in mehr oder weniger zivilisierte Umgangsformen verwandelt haben – wenn das überhaupt möglich ist; auf jeden Fall kann das lange dauern. Mit Gewalt ist nichts zu wollen, solange das Gesetz der Zone in achtzig, neunzig Prozent der Gesellschaft wirkt.“
O-Ton 20: Metro, Musik 0,38
Regie: Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, allmählich abblenden
Erzähler:
Was für ein Bild! Entspringt es nur der professionellen Schwarzmalerei zweier, zudem eher koservativer Redakteure? Kehren wir zu dem Eliteforscher und Transformationswissenschaftler Diskin zurück. Er konstatiert zunächst:
O-Ton 21: Dimitri Diskin (1,05)
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden
Übersetzer:
Nu, jesli goworits stroga…
„Streng gesagt haben wir keinen Kapitalismus erhalten. Kapitalismus, das hieße doch vor allem erst einmal Chancengleichheit im wirtschaftlichen Handeln, mindestens formal. Dafür sind gleiche Rechte des Eigentums unabdingbar. Das gibt es bei uns nicht, das ist offensichtlich! Bei uns ist das Recht auf Eigentum an die politische Macht gekoppelt. Was aber noch wichtiger ist: In der sowjetischen Zeit war Geld nicht das einzig Entscheidende. Geld im Kriegsgeschäft war wichtig, um Aufträge zu bekommen. Geld in der Leichtindustrie war etwas völlig anderes. Geld in der Hand des Volkes war noch etwas anderes. Bargeld war wieder etwas anderes. Viele verschiedene Gelder gab es. Auch heute gibt es in der Wirtschaft ganz unterschiedliche Gelder: Geld, das dir zum Beispiel von Budget aus zusteht, ist kein Geld, bevor es nicht bei dir angekommen ist. Wenn heute aus dem Budget nicht gezahlt wird, wenn der Lohn nicht gezahlt wird usw., dann heißt das alles nur eins: daß es heute immer noch unheimlich viel feudale Überbleibsel in unserer Wirtschaft gibt.“
Erzähler:
Dennoch sieht Diskin Rußland im Übergang vom traditionellen zum modernen. Was für den traditionellen Staat typisch sei – Mechanismen scharfer Kontrolle, unmittelbarer Sanktionen usw. – sei in den letzten zehn Jahren der sowjetischen, jetzt auch in der russischen Gesellschaft abgebaut worden. Andere Mechanismen hätten mehr Einfluß bekommen, solche wie die Freiheit der Wahl, des Vertrauens vor Kontrolle, der allgemeinen Wohlfahrt, der persönlichen Freiheit usw. Das Ganze sei aber ein langwieriger Prozess, der zudem nicht nur eine soziale Schicht betreffe. Er erfasse alle gesellschaftlichen Bereiche und sehr unterschiedlich entwickelte Regionen. Von daher könne es keinen geradlinigen Verlauf geben:
O-Ton 22: Diskin, Forts. 0,58
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, nach Übersetzer vorübergehend hochziehen, abblenden unterlegen
Übersetzer:
Na moi wsglad…“
„Meiner Ansicht nach hat sich in Rußland zur Zeit ein politisches System wie in den südamerikanischen Übergangsgegesellschaften entwickelt, ein System oligarchischer Clans, die auf der Basis finanzieller Vermögen und im Zugriff auf das Budget aufgebaut sind. Sie haben sich auch mit den transnationalen Monopolen verbunden. Diese Clans sind Banken, das sind ganze Imperien, auch der riesige Clan Michail Lyschkows zum Beispiel, des Moskauer Bürgermeisters; Gasprom, der Öl-Gas-Konzern, von dem so viel die Rede ist, kann als drittgrößtes Monopol der Welt gelten. Dazu kommen große Auslandsvermögen. Die Zusammenarbeit und die Widersprüche dieser Clane konzentrieren sich auf Moskau; dort kämpfen sie miteinander um den Einfluß auf das Budget. In den Regionen gibt es ein anderes, ein zweites System: Dort herrscht soetwas wie ein bereichsweiser Autoritarismus.“
…segmentirowannije awtoritarism.
Erzähler:
Die Führer der regionalen Elite und die Oligarchien, konkretisietisiert Diskin, repräsentierten unterschiedliche Interessen. Die Oligarchie hänge weithin mit Export, mit den außenwirtschafdem Belangen zusammen, die Gouverneure dagegen eng mit der weiterverarbeitenden Industrie, mit dem, was nicht so viel Geld bringe. Zwei antidemokratische Kräfte hielten sich auf diese Weise im heutigen Rußland die Waage. Machtbalance eines oligarchischen Pluralismus, lautet das Stichwort des Eliteforschers Diskin. Dabei faßt er die Kommunistische Partei als Clan unter Clans auf. Die Aufgabe des russischen Präsidenten sieht er darin, dieses Machtgleichgewicht zu erhalten.
Andere russische Soziologen haben andere Begriffe für diesen Zustand gefunden: So Tatjana Saslawskaja, die große alte Dame der neuen russischen Soziologie: Sie beschrieb die sowjetische Gesellschaft früher als „Verhandlungswirtschaft auf Gegenseitigkeit“, als eine undefinierbare Mischung aus Kapitalismus und Sozialismus. Die jetztigen Verhältnisse bezeichnet sie als „Monster krimineller Verfilzung“. Der Leiter des „Zentrums für Meinungsforschung“ in Moskau, Juri Lewada, spricht von „kriminellen Clans, die sich gegenseitig stabilisieren“. Das Ergebnis nennt er Normalität. Der im Westen bekanntere Grigorij Jawlinksi, unterlegener Kandidat in der Präsidentenwahl 1996, faßt die Situation unter dem Begriff des „Korporativismus“ zusammen. Kaum jemand erklärt jedoch, was diese Struktur trotz allem zusammenhält.
Einen Ansatz dazu macht Boris Kagarlitzki, radikaldemokratischer Reformsozialist, Perestroikaaktivist, Abgeordneter des Moskauer Stadtsowjets bis zur gewaltsamen Auflösung der Sowjetstruktur 1993.
Gefragt, was heute in Rußland umgebaut werde, antwortet er:
O-Ton 23: Boris Kagarlitzki 1,30
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
I eschtscho odin interesni aspekt…
„Es gibt einen Aspekt des sowjetischen Systems, der bis heute kaum beachtet wurde. Das ist die `Óbschtschinost´, die Gemeinschaftsstruktur der Arbeitskollektive. Was ist ein sowjetisches Arbeitskollektiv? Das ist im Grunde die alte zaristische Bauerngemeinschaft mit Gemeineigentum, russisch: Óbschtschina, nur ausgerichtet auf die Notwendigkeiten der industriellen Produktion. Im Zuge der schnellen Industriealisierung wurden die Bauern aus dem Dorf in die Stadt geworfen, und in der Stadt begannen sie sich sehr schnell nach fast den gleichen Prinzipien zu organisieren; der Staat selbst ist so organisiert. Für den Staat ist das bequem. Das ist kein westliches Proletariat, aber auch nicht das mythische Proletariat der sowjetischen Ideologie. Das gibt es sowieso nicht. Das ist die normale Nachbarschaftsgemeinschaft, aber organisiert rund um die industrielle Produktion. Dies umsomehr als man darumherum wohnt: Um die Fabrik herum entsteht die Stadt! Der Staat befaßt sich damit, die Betriebe zu verwalten und die Betriebe verwalten die Leute. Deshalb gibt es keine bürgerliche Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Untertanen und der Untertanen untereinander. In den Betrieben wirkt eine wechselseitige paternalistische Verantwortung: So schaut die Administration auf die Disziplin, und der Arbeiter müht sich um gute Arbeit usw.“
…i tagdali
Erzähler:
Boris Kagarlitzki sieht die russische Gesellschaft heute in drei Sektoren aufgeteilt: einen engen sog. formellen, vor allem in Moskau, St. Petersburg oder anderen Großstädten; man könne ihn auch als Enklave westlicher Wirtschaft bezeichnen; einen zweiten sog. nichtformellen, das, was gemeinhin als kriminell oder mafiotisch bezeichnet werde. Den dritten Sektor bilde die `Óbschtschina´, allerdings im Stadium der Auszehrung. Die Staatsmacht setze heute bewußt auf deren Zersetzung mittels Privatisierung, sozialer Differenzierung und Vernachlässigung der Gemeinschaftseinrichtungen; mit der Reformwelle von 1997, der sogenannten 2. Privatisierungs, sei ein erneuter Vorstoß dieser Art bebsichtigt gewesen. Als Antwort auf die Zerstörung der Lebensgrundlage der Bevölkerung entwickle sich aber schon seit geraumer Zeit eine Gegenbewegung direkt aus den Gemeinschaftsstrukturen heraus und es sehe so aus, als ob auch die aktuellen Angriffe an ihren Strukturen breche, weil die Óbschtschina, selbst in ihrer zerstörten Form, für viele die einzige Möglichkeit sei zu überleben.
Dazu kommt, so Boris Kagarlitzki, daß inzwischen auch in den Enclaven westlicher Wirtschaft Unzufriedenheit entstehe; dort komme jetzt ebenfalls Arbeitslosigkeit auf. Sie gefährde den neuen Lebensstandard, der sich daraus ergeben habe, daß man dort in westlicher Währung verdiente, aber in russischen Preise zahlte.
Wenn der Protest aus den Strukturen der Obschtschina, so Kagarlitzki, sich mit der Unzufriedenheit aus dem Bereich des modernisierten Sektors verbinde, könne daraus eine explosive Kraft erwachsen, die umso stärker sein werde, je mehr sich auch die örtliche Nomenklatura einmische. Worin solche Erwartungen begründet seien?
O-Ton 24: Kagarlitzki, Forts. 0,53
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
No, primerno, schto…
„Nun, etwa so: Alles wurde doch privatisiert! Alle wissen, daß viele Betriebe eben deswegen nicht mehr arbeiten, daß sie von Subventionen leben! Es gibt keine unternehmerische Bourgeoisie, also gibt es auch keine Investitonen und keine Ausssicht darauf. Es droht Hunger, Elend, Unruhe im Bezirk, in einigen Bezirken ist es schon so. Was machen die örtlichen Bürokraten? Sie beginnen die Betriebe vor Ort zu `nationalisieren´, wie wir sagen, d.h., erneut zu vergemeinschaftlichen. Im Ergebnis haben wir anstelle des alten monolithischen Staatssektors nunmehr dezentralisierte Staatssektoren mit örtlichen, gemeinschaftsbezogenen korporativen Verbindungen. Und das bedeutet: die Óbschtschina beginnt sich neuerlich zu rekonstruieren.“
…sebja rekonstruirowats.
Erzähler:
Außer Direktoren und höheren Bürokraten, so Boris Kagarlitzki, würden aus den Gemeinschaften auch die hinausgedrückt, die man heute in Rußland die „neuen Russen“ nenne. Demgegenüber bilde sich ein Mittelstand aus jenen neuen kleinunternehmerischen Kräften, welche die Interessen der Gemeinschaften bedienten, statt sie nur zu verbrauchen, also ihren privaten Profit aus der Befriedigung der Bedürfnisse der Gemeinschaft, statt aus deren Zerstörung erwirtschafteten:
O-Ton 25: Boris Kagarlitzki, Forts. 1,13
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Erzähler hochziehen.
Übersetzer:
Tschem asobenost novich ruskich…
„Denn was macht den `neuen Russen´ aus? Daß er die Óbschtschina im Ganzen ausbeutet! Die neuen Russen sind daran interessiert, die bestehende Ordnung aufrechtzuerhalten. Russsiche Betriebe sind bisher generell nicht auf Arbeitsbeziehungen westlicher Art, also der Ausbeutung von angestellter Arbeitskräfte, gegründet; sie sind aufgebaut auf Ausbeutung bestehender Ressourccen oder bestehender Kollektive. Und daran ändern die `neuen Russen´ nichts. Die meisten Betriebe dieser Art arbeiten zudem als äußerst spezialisierte Kollektive, die Geld von großen Kollektiven erhalten, die ihrerseits aus früheren staatlichen Betrieben zurückgeblieben sind, die jetzt privatisiert wurden. Die neuen Betriebe sind nur wie Transistoren, die Geld aus dem einen, alten Sektor der Wirtschaft, in den anderen, neuen schaffen. Darin besteht die Funktion dieser Firmen.“
…funkti etich firm.
Erzähler:
Damit, muß ergänzt werden, machen sie schnelles Geld, tragen aber wenig, bzw. nichts zur Investition in neue wirtschaftliche Strukturen bei. Kein Wunder, wenn die Gemeinschaften sich dagegen zu wehren beginnen und nach eigenen Wegen suchen.
Einen aktuellen Einblick in Vorgänge dieser Art vermittelt ein Ereignis im sibirischen Regierungsbezirk Irkutsk:
O-Ton 26: Versammlung Irkutsk 0,56
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, allmählich abblenden
Erzähler:
Ba uriwinje antimoskowskowo…
Gegen Moskau oder im Kompromiß mit Moskau? lautet die Frage, die hier auf einer Versammlung von gut zwanzig Vertretern aus Wirtschaft, Justiz und örtlichem Busyseness am Rande eines historischen Gedenktages der Region Irkutsk Ende 1997 verhandelt wird. Einer der Anwesenden, Oleg Woronin, ehemaliger Aktivist der Perestroika, heute Dozent an der historischen Fakultät von Irkutsk und erfolgreicher Geschäftsmann zugleich, spricht unter dem Thema: „Kompromiß als Weg“.
Ohne Mikrofon, heftig und mit oft überkippender Stimme, versucht er die Anwesenden von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Interessengegesätze der Moskauer Finanzclans für den Aufbau der regionalen Industrie zu nutzen. Einen Beraterstab zur Unterstützung der örtlichen und regionalen Bürokratie, ganz in dem von Boris Kagarlitzki skizzierten Sinne, will man bilden, der den regionalen Beamten zur Hand gehen soll. Nach der Veranstaltung erläutert der akademische Neuunternehmer genauer, was er unter „Kompromiß als Weg“ versteht:
O-Ton 27: Oleg Woronin 0,54
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzung:
Nu, ä, smisle dakladow…
„Nun, was ist der Gedanke des Vortrags? Ich denke schon lange und sehe es immer mehr so, daß die marxistischen Termini auf Rußland nicht zutreffen. Die Aufteilung in Klassen korrespondierte nicht mit der Realität, wie wir Soziologen sagen. Als Ergebnis der Stalinzeit hatten wir vielmehr, abgesehen von der Nomenklatura, eine destrukturierte, eine amorphe Gesellschaft. Reale, klar abgegrenzte soziale Strukturen gab es nicht; sie veränderten sich zu Quasi-Strukturen, die den von der Partei gezogenen Privilegiengrenzen folgten. Jetzt geht es darum, wie eine Wiedergeburt sozialer Strukturen in der gegenwärtigen Gesellschaft erfolgen kann.“
…sowremennom obschestwo.
Erzähler:
Dieser Vorgang, so Oleg Woronin, könne sich nur auf der Grundlage realer Interessen vollziehen, die Menschen verschiedener sozialer Schichten mittelfristig miteinander verbinde. Solche Interessenbündnisse gebe es zur Zeit nur bei den Kommunisten und bei den marginalisierten Randgruppen der Rechten bis hin zu Wladimir Schirinowski. Das Stillhalteabkommen zwischen ihnen und der Macht könne man wohl einen Kompromiß nennen; nur durch Ihn könne die Gesellschaft zur Zeit existieren, aber dieser Kompromiß beruhe auf Korruption und sei daher sehr brüchig:
O-Ton 28: Oleg, Forts. 0,38
Regie: Toon stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
Glawna eta..
„Das Wichtigste ist natürlich, daß die eigentlichen grundlegenden Strukturierungsprozesse in der Elite vor sich gehen. Das ist die finanzindustrielle Elite, die Unternehmerlite usw. In der Bildung der großen, korporativen, ich wiederhole: korporativen Monopole von der Art Gasproms, von der Art des russischen oder des Irkustker Energieverbunds und anderer vollziehen sich die Strukturierungen dringender mittelfristiger wirtschaftlicher Interessen.“
… interessom
Erzähler:
Gut zwei Dutzend solcher Industrie-Finanzgruppen sieht Oleg Woronin gegenwärtig miteinander darum kämpfen, wie die russische Torte endgültig aufgeteilt wird. Aber nicht große Privateigentümer sieht er an ihrer Spitze, sondern Top-Manager, die einem kollektiven sozialen Körper verpflichtet seien. Von der Gemneinschaft losgelöste Privatinteressen, so Oleg Woronin, hätten in diesem korporativen Zusammenhang keinen Platz. Den Ursprung dieser Strukturen sieht auch Woronin in der Óbschtschina; die heutigen Produktions- und Lebenszusammenhänge seien allerdings größer als die ihre klassischen Vorgänger; sie seien heute nicht mehr ans Dorf, ja, nicht einmal mehr mehr an einen Ort gebunden, sondern überregional, sogar international organisiert. In diesen Korporationen jedoch entwickle sich heute der soziale Kompromiß, den Rußland zum Überleben brauche:
O-Ton 29: Oleg Woronin, Forts. 0,54
Regie: O-Ton kommen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochzziehen
Übersetzer:
To est, strukturirowannije…
„Das alles heißt: Die Strukturierung der Gesellschaft läuft in den Bahnen sozialer Bindung von oben und unten. Selbstverständlich bilden die großen Banken, nachdem sie in der Privatisierung die staatlichen Vermögen an sich gerissen haben, zunächst Holdings usw. Aber danach sehen sie, daß sie ohne politische Versorgung der Bevölkerung nicht wirklich agieren können. Sie müssen Rücksicht auf die bestehenden sozialen Strukturen nehmen. Also kaufen sie Leute ein, Lobbyisten in der Duma, in der Regierung, in den Massenmedien; es ist vollkommen klar, daß sie in nicht allzuferner Zeit auch politische Parteien entweder selbst aufbauen oder finanzieren.“
…polititschiski strukturi.
Erzähler:
Gewerkschaften, so Oleg Worin, würden schon jetzt von ihnen finanziert. So unterhalte Gasprom eine Gewerkschaft der Gasarbeiter. Die Elektrogewerkschaft befinde sich unter der Kontrolle des russischen Energieverbundes, ähnliches gelte für den Irkustker Oblast. Die Mehrheit der Streiks im Kusbass, in Workuta und andernorts., so Oleg, seien direkt von den Direktoren dieser Werke inspieriert worden, von den Managern also. Es geht, so Oleg, um die soziale Legitimierung der neuen Machtstrukturen. Die immer neuen Umbesetzungen in Moskaus Regierungsetagen sind für ihn nur Ausdruck dieser Entwicklung:
O-Ton 30: Oleg Woronin, Fortsetzung 1,15
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzung:
Wosnawnoi takoi obsche smisl…
„Kern ist der Kampf um die reicheren, mehr Perspektive aufweisenden Unternehmen der Region. Aber das ist nur der erste Schritt. Die Kontrolle kann man sich leicht aneignen. Die Frage ist dann, wie können diese Betriebe arbeiten, insofern die Mehrheit von ihnen moralisch und physisch überaltert ist und, was die Hauptsache ist, über keinerlei Investitionsmittel verfügt? Die Banken fordern Rationalsierungen: Das bedeutet Einsparung des Personals, Abbau sozialer Strukturen wie Kindergärten, Kinderclubs, Lager für Kinder, Krankenhäuser usw. Alles, was früher die Unternehmen aus ihrem Gewinn unterhielten, wird jetzt den Gemeindebudgets zugeschoben. Die haben aber kein Geld; es wird praktisch der Vernichtung anheimgegeben. Das heißt, dieser aktuelle Prozess in der Übereignung des Eigentums läuft ziemlich krank ab.
…dstatischno bolesno.
Erzähler:
Trotz dieser Kritik gibt sich auch Oleg Woronin zuversichtlich, daß langfristig eine entscheidungsfähige Elite und ein lebensfähiger Mittelstand aus diesen Kämpfen enstehen werde. Aber kann die Bevölkerung solche Langfristigkeit ertragen?
O-Ton 31: Oleg, Ende 1,18
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach erstem Erzähler hochziehen, abblenden
Nu, nawerna…
„Nun, wahrscheinlich! Das Niveau des Konsums steigt zwar nur langsam, für einige Teile der Bevölkerung fällt er sogar, weil sie einfach kein Geld haben; das ist natürlich gefährlich; aber die Menschen gewöhnen sich daran, daß es besser ist, sich um das Eigene zu kümmern. Sie kümmern sich um die kleine Gemeinschaft, die Familie, möglicherweise auch die große Familie im Dorf, in der Stadt, auch um die große kooperative Familie der Stadt, auf dem Lande, schließlich um die große Wirtschaft. Das heißt nur, daß die Menschen mehr und mehr an sich glauben und nicht an den Staat. Und wenn sie mit ihren eigenen Dingen beschäftigt sind, werden immer weniger protestieren und so werden allmählich normale Arbeits- und Lebensstrukturen entstehen.“
Regie: hochziehen, abblenden
Erzähler:
Die weitestreichenden Veränderungen sehen André Fursow und Juri Perawar kommen. Sie sind Dozenten an der Afanasjew-Universität in Moskau. Dort werden nicht nur Manager und Managerinnen ausgebildet wie Vera, die wir im Büro des Abgeordneten der Moskauer Duma antrafen. Die Humanistische Universität Moskau versteht sich gerenell als Elite-Schule. Ihr Motto lautet: Bildung ist Macht. Neuerdings wurde dort ein gesondertes Institut für russische Geschichte eingerichtet. André Fursow und Juri Perawar leiten dieses Insitut. Auf die Frage, wie angesichts des Zerfalls der früheren Zentralmacht in Zukunft in Rußland gesellschaftliche Kontrolle ausgeübt werden könne, verweist André Fursow auf die beschleunigte Computerisierung des Landes:
O-Ton 32: Afanasjew-Uni 0,39
Regie: Ton stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
Ponimaetje,tak. Vot scomputerom…
„Verstehen Sie, mit den Computern ist das so: Mit dem Computer sind zentralsisierte Strukturen schon nicht mehr notwendig, um Menschen zu kontrollieren. Die bolschgewistische Diktatur hat, als sie zur Macht kam, die Unterschiede zwischen privater und öffentlicher Sphäre aufgehoben. Dasselbe macht heute schon der Computer. Durch ihn kann die Macht direkt auf dein Leben zugreifen. Jetzt braucht man keinen KGB, keine Gestapo mehr; man braucht nur noch den Computer; das ist alles.“
… i wsjo
Erzähler:
Der Befürchtung, dies könne in neuer Diktatur oder heilloser Anarchie enden, widerspricht sein Kollege Juri Parawar. Seit Anfang des Jahrhunderts, erklärt er, sei auch der russische, dann der sowjetische Mensch, wenn auch in brutalen Formen, so doch durch eine ähnliche historische Schule gegangen wie die Westeuropäer. Weiterhin von elementarem Anarchismus des russischen Menschen zu sprechen, der nur durch äußere Macht gezügelt werden könne, sei nicht mehr vertretbar:
O-Ton 33: Afanasjew, Forts. 0,48
Regie: Ton stehen lassen, abblendeb, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
potamuschta smotritje……
„Denn sehen Sie! Alles brach seit 1990 zusammen, und doch hat kein allgemeiner Bürgerkrieg eingesetzt, keine weiteren Katastrophen vom Typ Tschernobyls usw. Das spricht, bei aller Skepsis, die ich für die nächste Zukunft unseres Landes habe, davon, daß während des Kommunismus bei uns doch ein historisches Subjekt entstand, das man dem europäischen oder westlichen der Richtung nach vergleichen kann. Es ist noch nicht in dem Maße rechtsstaatlich orientiert – wie die Deutschen beispielsweise. Aber es ist doch schon nicht mehr der wilde Mensch, der es im 19. Jahrhundert war.“
…datnatzatom wekje
Erzähler:
Damit ist eine Hoffnung formuliert.
O-Ton 34: Musik
Regie, langsam kommen lassen, nach Ende des Textes hochziehen, allmählich abblenden.
Erzähler:
Ob sie Wirklichkeit werden kann, hängt nicht nur von denen ab, die die Computer programmieren oder verkaufen, sondern auch von denen, die sie benutzen. Eine Elite, oder die, die sich dafür halten, kann letztlich nur so kriminell sein, wie die Bevölkerung es zuläßt. Wie mächtig die neue russische Elite ist und wie sehr sie den traditionellen Gemeinschaftstrukturen verpflichtet bleiben wird, genauer gesagt, wieder verpflichtet werden kann, ist eine Frage, die noch nicht entschieden ist.
Von dieser Sendung existieren außerdem unterschiedlich lange Kurzfassungen