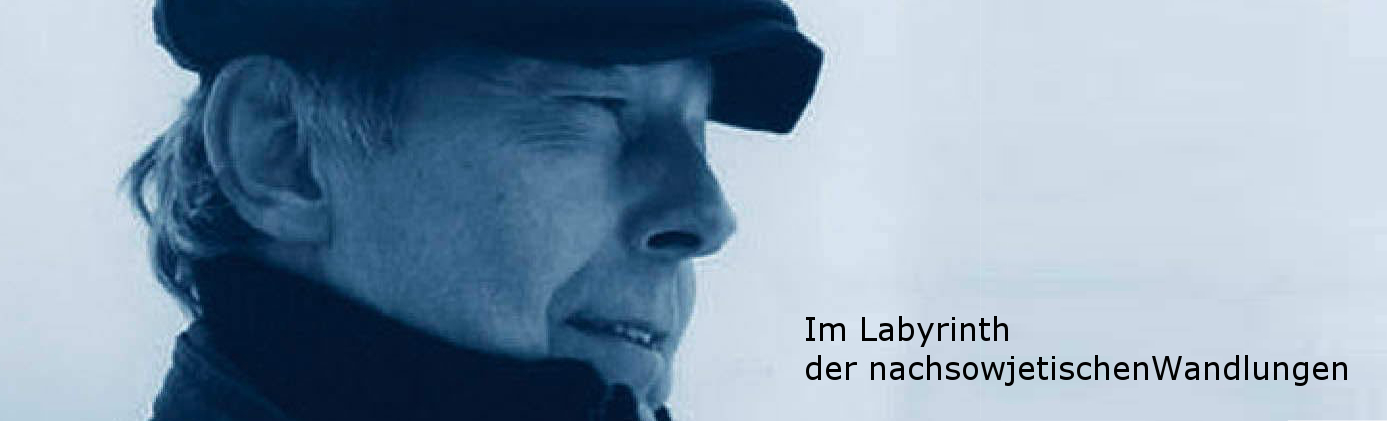Europa ist ins Gerede gekommen. Vom alten Europa wird
gesprochen, vom neuen, von europäischer Schwäche, von
notwendiger europäischer Stärke. Der Euro ist dabei, den
Dollar zu überholen, aber die europäischen
Kernwirtschaften sind in der Krise. Was ist los mit Europa?
Ist Europa das Modell für die Gesellschaft von morgen oder
ist es ein Überbleibsel von gestern, das sich gegen den
Fortschritt der Globalisierung abschottet?
Europäische Intellektuelle streiten: Der französische
Philosoph André Glucksmann nannte Europa einen Vogel
Strauß, der seinen Kopf vor der Realität in den Sand stecke.
Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger
kleidete seine Kritik an einem, wie er meint,
handlungsunfähigen Europa in das Bekenntnis, der Fall
Saddam Husseins habe ein Gefühl des Triumphes bei ihm
ausgelöst. Professor Jürgen Habermas erklärte, zugleich mit
dem Sieg über den IRAK hätten die USA ihre moralische
Autorität eingebüsst.
In der Welt der ehemaligen europäischen Kolonien sind die
Sympathien klar verteilt: Europa ist der Traum, die USA
sind die Wirklichkeit. „Europa“, sagte kürzlich der
Vorsitzende einer städtischen afghanischen Gemeinschaft
zu mir – einer von denen, die nach dem Rückzug der
Sowjets aus Afghanistan ins Exil gingen und heute von
Europa aus um den demokratischen Aufbau Afghanistans
bangen: „Europa, das war für uns in Afghanistan, seit ich
denken kann, immer der zivile Weg der Entwicklung: Das
war Wohlstand, Frieden und Toleranz, Pluralität. Die USA
stehen bei uns für das Gegenteil: Sie stehen für Gewalt, für
Zerstörung von Tradition und gewachsener Identität. Das
Problem mit Europa ist, dass es dabei zuschaut.“ Solche
Töne hört man nicht nur aus afghanischem Munde: „Ihr
wachst zusammen, wir dagegen zerfallen,“ so schallte es
dem europäischen Reisenden zu Hochzeiten der Perestroika
auch aus dem Kernland der Transformation, aus Russland
entgegen. Und auch in Russland wird klar zwischen Europa
und den USA unterschieden.
Ethnische Entmischung, kulturelle Differenzen,
wirtschaftliche Ungleichheiten sind in der globalen
Umbruchsituation, welche auf die Öffnung der bi-polaren
Welt zur Globalisierung folgte, heute weltweit das Problem
Nummer eins. Europa verkörpert die Vision einer Ordnung,
die über das gegenwärtige Chaos hinausweist – und zwar
nicht trotz, sondern wegen seiner Schwäche. Während der
Invasion in den IRAK wurde Europa gerade wegen seiner
mangelnden Kriegsbereitschaft für viele zur Hoffnung auf
einen zivilen Weg aus der Krise.
Ist Europa heute also der Träger des allgemeinen
demokratischen Impulses, während die USA das koloniale
Erbe des alten Europa in einem neuen Empire
globalisieren? Ist Europa der Phönix, der aus der Asche der
europäischen Kolonialordnung als Guru einer neuen
pluralistischen und kooperativen, kurz: demokratischen
Völkergemeinschaft wiedergeboren wird?
Regie: Musik
Zunächst muss man wohl wissen, was Europa nicht ist:
Europa ist keine feststehende Größe, Europa ist ein
Prozess: Europa – das war ein mühsamer, immer wieder
von Kriegen und Katastrophen zurückgeworfener Aufstieg
vom Spätentwickler der Menschheitsgeschichte zur
imperialen Vormacht der Welt, Europa – das ist der Fall
von dieser Höhe in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts –
die Weltkriege, der Faschismus, der Stalinismus – und
danach der mühsame Wiederaufstieg zum zivilen Partner
der Völkergemeinschaft in einer nachkolonialen Welt.
Europa ist die Kraft der Geschichte, welche die Welt
am nachhaltigsten umgestaltet hat, obwohl seine
natürlichen Wiegengaben dafür anfangs eher ungeeignet
waren: Die zerrissene Insellandschaft zwischen
Mittelmeer, Atlantik und den Nordmeeren war noch eine
Eis- und Sturmwüste, als andere Teile der Erde bereits erste
Kulturen hervorbrachten. Europas Geschichte beginnt erst,
als das Eis zurückweicht und Menschen aus wärmeren
Gegenden der Erde in die sich erwärmenden Gebiete
einwandern. Durch den Golfstrom wurde der europäische
Raum dann allerdings zum klimatischen Paradies. Mit
anderen Worten: Europa ist nicht erst heute zum
Einwanderungsland geworden, die Einwanderung ist der
Ursprung seiner Geschichte.
Die Impulse für Europas Entwicklung liegen
sämtlich außerhalb des heutigen europäischen
Kerngebietes: Aus dem Süden floss der mesopotamische
und ägyptische Kulturstrom; aus Zentralasien kamen die
Ionier, die Dorer, die Thraker und andere halbnomadische
Stämme geritten. In Kleinasien, Sparta, Athen,
Griechenland brachten sie ihre Kultur zur Blüte, als im
heutigen Europa noch die Bären brüllten Unter Alexander
I. drangen sie bis in den persischen Raum vor; die Barbaren
des Nordens interessierten sie nicht. Die Römer machten
das Mittelmeer zum Binnenraum ihres Imperiums, das sich
ebenfalls bis nach Asien erstreckte; die Völker des Nordens
grenzten auch sie als Wilde aus der römischen Welt aus.
Erst die Teilung in ein ost- und ein weströmisches Reich
gegen Ende des vierten Jahrhunderts westlicher
Zeitrechnung schuf die Voraussetzungen für den Beginn
einer zivilisatorischen Entwicklung des heutigen
europäischen Raums. Richtig los ging es sogar erst mit der
noch viel später erfolgten Teilung der christlich-römischen
Welt in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinischfränkische
Entwicklungslinie. Zu dem Zeitpunkt zählte man
aber bereits das 8., 9. und 1o. Jahrhundert nach Christi
Geburt: Hochkulturen in anderen Teilen der Erde – die
mesopotamischen, die asiatischen, die amerikanischindianischen
– hatten schon mehrere Zyklen hinter sich; die
arabisch-islamische Kultur schaute von großer Kultur-Höhe
auf die unbehauenen Barbaren im europäischen Norden
herunter. Erst in den Kreuzzügen, mit denen es die
muslimische Expansion zurückdrängte, entwickelte Europa
den Ansatz einer eigenen Identität. Die Kreuzzüge waren
die eigentlichen Geburtswehen Europas.
Aber dem Sturm der Mongolen entkam dasselbe
Europa ein paar Generationen später dann nur durch einen
historischen Zufall: Der mongolische Großkhan starb just
zu der Zeit, als die vereinigten Ritterheere des westlichen
Europa in der Schlacht bei Liegnitz 1251 von den
mongolischen Angreifern vernichtend geschlagen waren.
Die europäischen Fürstentümer bis hinein nach Gibraltar
lagen offen vor dem mongolischen Heer. Nur durch die
Tatsache, daß die feindlichen Heerführer ins ferne
Karakorum zurückehren mussten, um bei der Wahl des
neuen Khan anwesend zu sein, verdanken die Europäer,
daß sie von mongolischer Fremdherrschaft verschont
blieben.
Im Treibhaus dieser Enklave am westlichen Rande
des mongolischen Großreiches entstand Europa, in einer
fränkischen und in einer Moskauer Variante, einer
westlichen und einer östlichen also. Verbindendes Element
war das Christentum, wenn auch in die byzantinischorthodoxe
und die lateinische Linie gespalten. Dazu kam
die gemeinsame Feindschaft gegen Asiaten und den Islam.
Versuche, das in dieser Weise halb vereinte halb geteilte
Europa zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden und
als Weltreich zu etablieren, blieben jedoch immer wieder
erfolglos, wenn nicht gar in Katastrophen endeten: Die
Bemühungen Karl V., ein einheitliches christliches Reich
zu schaffen, in dem die Sonne nie untergehen sollte,
scheiterten an der Reformation. Der darauf folgende
30jährige Krieg, verwüstete Europa nicht nur, sondern
zerstückelte es. Die napoleonischen Träume führten in die
mörderischen Kriege der europäischen Nationalstaaten. Mit
Hitler kamen die Versuche, Europa gewaltsam zu einen,
endgültig zum Abschluss: Der nationalsozialistische Traum
von Groß-Europa, das die Welt beherrschen sollte,
hinterließ nicht nur Deutschland, sondern weite Teile
Europas in Ruinen, entledigte es seiner Kolonien und
vertiefte seine historischen Ost-West-Bruchlinien zur
Spaltung in zwei getrennte Welten. Das brachte den
Kontinent an den Rand seiner Existenz, während der
Kampf um die Weltherrschaft an die beiden rivalisierenden
neuen Weltmächte USA und UdSSR überging.
Regie: Musik
Ungeachtet ihrer Zerrissenheit, vielleicht sogar gerade
deswegen entwickelte sich aus der Enklave Europas jedoch
eine Expansionsdynamik, die ihresgleichen in der
Geschichte der Menschheit bis dahin nicht hatte: Die
Chinesen, obwohl hochentwickelt, begnügten sich mit der
Sicherung des chinesischen Beckens; zu ihren Hochzeiten
hatten sie eine Flotte, sogar Ansätze einer Industrie, aber
sie schufen damit kein überseeisches Imperium. Die
Pharaonen begrenzten ihre Herrschaft auf ihre Verewigung
in den Pyramiden. Die Griechen kamen über die Polis und
deren philosophische Begründung letztlich nicht hinaus;
Alexander I. war bereits ein Usurpator ihrer Geschichte.
Die Römer beließen es bei der Ausgrenzung der von ihnen
unterworfenen Kulturen aus dem mediterranen Kern des
Imperiums, bis sie von ihnen überrannt wurden. Selbst die
überaus mobilen Mongolen erschöpften sich nach wenigen
Generationen in der Verwaltung des Eroberten. Darüber
hinaus gab es bei ihnen keine verbindende Ideologie. Nur
der Islam entwickelte zeitweilig eine annähernd
vergleichbare Dynamik wie Europa, bis er sich durch
Traditionalismus und Fatalismus ausbremste. In der
europäischen Entwicklung dagegen verband sich die
Vielfalt und die Enge des europäischen Kontinentes mit
dem missionarischen Impuls des Christentums zu einer
durchschlagenden und ungebremsten Herrschafts-Ideologie
– europäische Missionare trieb es an alle Höfe, in alle
Hütten, Zelte und Krale der Welt in dem Bemühen, auch
noch die letzte Seele für Gott zu gewinnen; Politiker und
Kaufleute aus Europa sorgten dafür, daß die notwendigen
Mittel dafür aus den Weiten des Globus herangeholt
wurden – im Westen Europas per Schiff über die Ozeane,
im Osten zu Pferde quer durch die Weiten der asiatischen
Steppen.
Bei allen Differenzen gleichen sich die zwei Seiten
des christlichen Abendlandes letztlich in einem: In dem
Willen zur Missionierung und kolonialen Unterwerfung der
Welt. Gerade weil er nicht aus einem einheitlichen
Kommando kam, sondern aus einem vielgliedrigen,
differenzierten und widersprüchlichen Prozess hervorging,
verwirklichte er sich umso nachhaltiger und totaler;
fünfhundert Jahre benötigte Europa für den ersten Schritt:
Das reichte von Karl I. bis Christopher Columbus im
Westen Europas, also vom Beginn des 9. Jahrhunderts bis
zum Jahre 1492, das reichte von der Kiewer Rus bis zum
Sieg Iwan III. über die Tataren, also von 882 bis 1480, im
europäischen Osten. Aber nach der Entdeckung Amerikas
durch Columbus und nach Iwans III. Sieg über die
Tataren-Mongolen expandierte der europäische
Kolonialismus geradezu explosionsartig, im Westen in
seiner maritimen, im Osten in seiner territorialen Variante.
Am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet Europa deshalb vor
allem eines: Herrschaft! Im Falle der Russen war es die
Selbstherrschaft innerhalb eines Imperiums, im Falle der
westlichen Europäer die Fremdherrschaft über Gebiete in
Übersee; das Verbindende aber war die Unterwerfung von
Kolonien.
Europa, das war bis hinauf zum 1.Weltkrieg der
Export des christlich-abendländischen Willens zur
Veränderung und zur Beherrschung der Welt. Materiell
bedeutete das: Ausbeutung der weltweiten Ressourcen
durch die Europäer; ideologisch bedeutete es:
Christianisierung oder Unterdrückung traditioneller
einheimischer Kulturen bis hin zu deren gezielter
Vernichtung. Es war eine rücksichtslose Expansion, die mit
brutaler Gewalt durchgesetzt wurde. Produkt dieser
Herrschaft war der weltweite Export der Industrialisierung
und der damit verbundenen Lebensweise.
Nichts schien diese Expansion aufhalten zu können.
Dann aber, im Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert
wurde die Welt zu eng für Europas weitere Expansion: In
Afghanistan prallten die Landmacht Russland und die
Seemacht England aufeinander, in Nordafrika standen sich
Briten und Franzosen gegenüber. Als die Deutschen,
gestärkt durch die Reichseinigung von 1871, sich
anschickten, den Briten mit dem Bau einer eigenen
Hochseeflotte die Seehoheit streitig zu machen, war der 1.
Weltkrieg praktisch eröffnet. Es bedurfte nur noch des
Anlasses. Der Krieg wurde zur Festigung der entstandenen
kolonialen Ordnung geführt – was er brachte, war der erste
Schritt zur Emanzipation der Kolonien. Der 2. Weltkrieg
vollendete diesen Niedergang der europäischen
Kolonialmächte bis zur Unabhängigkeit der meisten
Kolonien und der Spaltung Europas. Mit Spaltung war
Europa allerdings nicht einfach geografisch geteilt, wie es
sich in Stammtisch-Erinnerungen darstellt, also
kommunistisch im Osten und kapitalistisch im Westen; es
teilte sich vielmehr in einen staatskapitalistischen Osten
und einen Westen, der sich auf soziale Marktwirtschaft
orientierte. Die eine Seite Europas war als deren Gegenbild
in der anderen enthalten; aber die beiden Seiten waren nicht
miteinander vermittelbar, weil jede Seite Vorposten ihres
jeweiligen Lagers war. In der Berliner Mauer fand diese
Konfrontation ihren schärfsten Ausdruck. Doch die Teilung
war nicht nur ein deutscher, sie war ein europäischer
Niedergang. Nach 1945 wurde Europa faktisch zum Vorhof
der Supermächte USA und UdSSR, Osteuropa und die
DDR wurden Satelliten der UDSSR, West-Deutschland und
Westeuropa wurden zu Juniorpartnern der USA. Aus
Herrenvölkern waren vom Kriege ermüdete mittlere
Mächte geworden.
Regie: Musik
Gerade in Europas Niedergang liegt aber auch der Keim
seiner Wiedergeburt als Hoffnungsträger für eine zivile
Weltordnung: Der Schock der beiden Weltkriege
manifestierte sich am radikalsten in der deutschen Formel:
Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und in der
Entwicklung West-Deutschlands zum demokratischen
Vorzeigestaat der kapitalistischen Welt und
Ostdeutschlands zum Aushängeschild des demokratischen
Sozialismus. Dass die DDR noch weniger sozialistisch als
die BRD musterhaft demokratisch war, ändert nichts an der
Tatsache, daß beide Teile Deutschlands die Vorzeigestücke
des jeweiligen Systems waren. Mit der Vereinigung beider
Hälften 1989 kamen sie zu einem neuen Ganzen
zusammen, dessen Charakter, auch wenn die Vereinigung
unter der Dominanz des westlichen Teils stattfand, bis
heute noch nicht wirklich klar ist.
Die Wiedervereinigung Deutschlands war auch eine
Wiedervereinigung Europas. Sie beschloss den
schrittweisen Aufstieg West-Europas aus dem
Nachkriegschaos zu demokratischer Pluralität. Nie wieder
Hegemonie einer europäischen Macht war das treibende
Motiv dieses Integrationsprozesses, der 1949 mit der
Gründung des Europarates begann, 1957 in die Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft überging und
zur Europäischen Union führte. Als Michael Gorbatschow
mit der Öffnung der Mauer 1989 der Integration
Westeuropas die Demokratisierung Osteuropas hinzufügte,
wurde Deutschland zum Verbindungsflur des neu
entstehenden gesamt-europäischen Hauses. Mit der
Osterweiterung der Europäischen Union sind inzwischen
weitere neue Mieter in dieses Haus eingezogen.
Ob dieses Haus sich allerdings bis nach Wladiwostok
erstreckt, wie manche meinen, darf bezweifelt werden.
Zwar ist Russland bis zum Ural zweifellos Teil der
europäischen Geschichte und dies begründet eine
besondere Beziehung Moskaus zur Europäischen Union,
aber Moskaus sibirische und zentralasiatische Territorien
gehören heute ebenso wenig zur Europäischen Union wie
die ehemaligen und verbliebenen Rest-Kolonien des
westlichen Europa. Die Zeiten, in denen sich Europa als
Herz einer weltweiten Kolonialordnung definierte, sind
endgültig vorbei.
Regie: Musik
Der Einfluss Europas auf die Welt ist heute nicht mehr
durch koloniale Bindungen vermittelt, sondern durch seine
wirtschaftlichen Beziehungen. Darüber hinaus liegt
Europas Anziehungskraft heute in seiner nach-kolonialen
Botschaft. Die Hausordnung in Europas Neubau, die oft
zitierte europäische Wertegemeinschaft, die aus den
Trümmern des alten imperialen Europa hervorgegangen ist,
enthält diesen Anspruch: Danach ist Europa die
Überwindung des Nachkriegs-Chaos durch wirtschaftliche
und zivile Kooperation in Europa selbst und darüber
hinaus. Europa ist ein Beispiel für die Möglichkeit von
Integration in schweren Zeiten. Europa ist Vielfalt der
Kulturen und Toleranz. Europa ist eine Gesellschaft, die
dem Prinzip des Sozialstaates verpflichtet ist. Europa ist
Demokratie. Europa ist Mobilität. Europa ist
Regionalmacht im globalen Geflecht. Europa ist
Katalysator einer neuen pluralen Weltordnung. In Europa
steht Pluralismus nicht nur in der Hausordnung, er wird
auch philosophisch, sozial- und bildungspolitisch gefördert.
Europas Philosophen treten für eine Kultur der Vielfalt ein,
die Europäische Union fördert Programme zum Schutz von
Minderheiten aller Art, eine „Pädagogik der Vielfalt“ wird
an den Universitäten, Lehr- und Bildungsanstalten auch auf
alltäglichem Niveau offiziell gefördert. Mit dem Titel
„Herausforderung Vielfalt“ ist beispielsweise eine
Internationale Konferenz überschrieben, die vom
Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des
Landes Schleswig-Holstein unter Beteiligung kirchlicher
Träger im Sommer 2003 durchgeführt wurde. Da geht es
um „Fremdheit und Differenz,, um „Pluralisierung und ihre
Folgen“, um “Strategien gegen Diskriminierung“, um
Perspektiven für die Entwicklung einer „Kultur der
Anerkennung“, die nicht nur das Fremde dulden und
akzeptieren, sondern das Fremde, das Andere als
Bereicherung des Menschseins erleben soll.
In Europa finden die Gegenbewegungen zur
Globalisierung, die in den USA zur Zeit entstehen, ihren
fruchtbarsten Boden: Die neueste US-Botschaft dieser Art
schwappt derzeit unter dem Stichwort „managing diversity“
nach Europa hinüber. Sie ersetzt das Leitwort von der
„corporate identity“, das bisher im Management gegolten
hat. Bemerkenswert daran ist nicht, daß die USA als
Stichwortgeber für Europa fungieren, bemerkenswert ist,
dass das Stichwort der „managing diversity“ gerade jetzt
aus den USA kommt und gerade jetzt in Europa Fuß fasst,
da sich eine konservative US-Regierung anschickt, den
gesamten Planeten gewaltsam unifizieren zu wollen.
Selbstbestimmung in einer Welt des bewusst
gestalteten Pluralismus, der gegenseitigen Anerkennung
und Hilfe der Menschen und der Völker, das ist heute
Europas gute Botschaft. Sie geht als Impuls auch in die
Globalisierung ein: Multipersonal, multikulturell und im
politischen Raum schließlich auch multipolar – das sind die
Begriffe, auf die sich diese Botschaft bringen lässt. Sie
schaffen Identität in Zeiten der Globalisierung, denn sie
helfen dem einzelnen Menschen, gleich welchen
Geschlechtes oder Alters, welcher Hautfarbe oder welchen
Standes den Ort ihrer Selbstverwirklichung und damit ihrer
Würde als Menschen zu finden. Politisch gilt das auch für
die Völker. Diese Botschaft ist eine echte Alternative zu
den Versuchen der unipolaren militärischen
Disziplinierung, die zur Zeit von den USA ausgehen.
Regie-Musik
Aber Europa hat auch ein anderes Gesicht. „Dieser Trend
zur Pluralisierung verläuft nicht geräuschlos und schon gar
nicht konfliktfrei“, heißt es z.B. in den Kommentaren der
an Vielfalt engagierten schleswig-hosteinischen
Pädagogen: „Es geht immer um Eingriffe in die bisherige
Verteilung von Macht. Prozesse der
Fundamentaldemokratisierung stoßen auf das Bestreben,
Privilegien zu verteidigen und jene Machtmittel möglichst
unsichtbar zu machen, mit denen sie aufrechterhalten
werden. Sie werden auch intrapsychisch so versteckt, dass
Angehörige des gesellschaftlichen „Mainstreams“ ihre
Privilegien überhaupt nicht mehr wahrnehmen.“. i
Die Botschaft der Pluralität, heißt das, kann sich in
die Verteidigung der Pluralität gegen tatsächliche oder
vermeintliche Gefährdungen von außen verwandeln.
Auch dies ist keineswegs neu für Europa: Als
Einwanderungsland entstanden, haben die in Europa
Ansässigen sich doch immer gegen neue Einwanderer
gewehrt: Bereits Rom baute den Limes gegen die Völker
des Ostens, gegen die Zuwanderung aus den asiatischen
Steppen, gegen die Hunnen Attilas; den Norden Europas
befriedete Cäsar durch Unterwerfung, welcher bekanntlich
nur ein kleines gallisches Dorf an der Küste der Normandie
widerstand… Spätestens mit den Kreuzzügen gräbt sich das
Verständnis von Europa als Bollwerk gegen die
Ungläubigen tief in dass kollektive europäische
Unterbewusstsein ein – in Ost-Europa nicht viel anders als
im Westen: Danach waren die Muslime, die Sarazenen, die
Türken oder wie immer man sie nannte, gottlose
Ungeheuer, welche die Christenheit verschlingen wollten.
Vor ihnen galt es die Menschheit zu retten. Die Aufrufe
Papst Urban II. und späterer Päpste, zum Töten der
Ungläubigen auszuziehen und dafür das ewige Leben zu
ernten, lassen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig.
Das ganze frühe Mittelalter, einschließlich der
Heldensagen, ist von der Totschlag-Romantik der
Kreuzritter geprägt.
Auf den Grundsteinen des Kreuzrittertums wurde
wenige Generationen später die Festung gegen die
Mongolen ausgebaut. Tschingis Chan galt ihren
Verteidigern als Kinderfresser, in ihm verschmolzen alle
bisherigen Feinde zur asiatischen Gefahr, zur Bedrohung
durch das Andere schlechthin, zum Anti-Christ;. Die
Kirche erklärte Tschingis Khan zur Geißel Gottes, die Gott
zur Prüfung der Menschheit geschickt habe. Besondere
Verdienste bei der Verteidigung gegen diese Gefahr nahm
dabei Russland für sich in Anspruch, das sich die Rettung
des christlichen Abendlandes vor den Mongolen zu gute
schrieb, ohne sich daran zu stören, dass dies die
historischen Tatsachen zurechtbog, da Europa, wie gesagt,
seine „Rettung“ lediglich dem Wechsel der Khane in
Karakorum zu verdanken hat. Ungeachtet solcher
Feinheiten konnte Joseph Goebbels die Skizzen des von
ihm geschaffenen russischen Untermenschen später nach
dem mittelalterlichen Klisché von Hunnen und Mongolen
fertigen lassen, die sich, krummbeinig, hässlich, mit einem
Säbel zwischen den Zähnen in die Mähnen ihrer ebenso
hässlichen Ponys klammern, um so das Abendland zu
überfluten.
Im Schreckensruf „Die Türken vor Wien“ festigte
sich das abendländische Bedrohungs-Syndrom im 17.
Jahrhundert weiter. Mit der Niederlage der Türken im Jahre
1683 löste sich zwar der Druck auf West-Europa; für Ost-
Europa wurden die Türken und alle mit ihnen verwandten
und verbundenen Völker in den folgenden Kriegen
zwischen Russland und der Türkei jedoch nicht nur zum
wichtigsten Gegner, sondern auch zum inneren Feind.
Diese Spur zieht sich bis ins heutige Russland, wo die
„Tschornije“, die Schwarzen, das rassistische Hassobjekt
für den russisch-orthodoxen christlichen Chauvinismus
sind. Auch der gegenwärtige westeuropäische Rassismus ist
nicht frei von diesem Klisché.
Im eisernen Vorhang, der West-Europa von Ost-
Europa, noch mehr aber den Westen von Asien trennte,
fand die Mär vom abendländischen Bollwerk gegen die
asiatische Bedrohung seine neuzeitliche Aktualisierung: Im
Bild des sowjetischen Kommunismus, der hinter dem
eisernen Vorhang nur darauf lauert, das verbliebene
christliche Abendland zu verschlucken, verwoben sich die
alten Klischés von Attila bis zu den Türken zum
kollektiven Wahnbild einer kommunistischen Bedrohung
aus dem Osten, für das der US-Präsident Ronald Reagan
noch kurz vor Gorbatschows Perestroika-Kurs schließlich
die schöne Bezeichnung vom „Reich des Bösen“ erfand,
vor dem die USA die Welt beschützen müssten.
Heute ist auch das Böse globalisiert. An die Stelle
des eisernen Vorhangs ist die weltweite Front gegen den
internationalen Terrorismus getreten. Das „Reich des
Bösen“ ist zur asymmetrischen „Achse des Bösen“
geworden. Aber ob asymmetrisch oder nicht, in dem Aufruf
gegen die „Achse des Bösen“ treten auch die traditionellen
europäischen Bedrohungs-Syndrome in neuer Gestalt
wieder hervor, aufgebaut von Ideologen, die den globalen
Kampf der Kulturen als Menetekel an die Wand malen und
durch einen US-Präsidenten, der zum Kreuzzug gegen das
Böse aufruft.
In diesem Kampf wird alles ausgegrenzt und
tabuisiert, wodurch sich die christlich-abendländische
Wertegemeinschaft bedroht fühlt; das ist, klar gesprochen,
alles, was nicht weißhäutig, nicht christlich und nicht
hochindustrialisiert ist. Ausnahmen machen die nichtweißen
US-Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch
nur, solange sie offizielle Repräsentanten der Supermacht
Nr. Eins sind. Ausnahmen machen auch die Menschen und
Völker, die man als Bündnispartner braucht, aber nur,
solange sie sich gebrauchen lassen. Das erinnert stark an
die Praktiken früherer Imperatoren, etwa jene der Römer,
welche Germanen, Hunnen und andere so lange hofierten,
wie sie als Grenztruppen andere Völker vor den Grenzen
aufhielten.
Im Namen von Vielfalt, Liberalität und
Selbstbestimmung, heißt das, beginnen sich Europäer
heute gegen eben diese Vielfalt, Liberalität und
Selbstbestimmung zu wenden. Ausdruck davon sind
politische Strömungen wie die Partei des ermordeten
Niederländers Pym Fortyn, die mit liberaler Argumentation
eine im Kern rassistische Ausgrenzungspolitik vertreten:
Wohlfahrt, Vielfalt und Selbstbestimmung ja, lauten ihre
Parolen, aber nur für Bürger Europas, nicht für Ausländer –
die sollen bleiben, wo sie geboren sind. Ausdruck dieser
Wende sind auch Positionen wie die des englischen
Premiers Tony Blair, der eher bereit ist, die demokratische
Grundsubstanz des europäischen Pluralismus den
Zentralisierungsforderungen der USA unterzuordnen, als
ein „multipolares Chaos“ zu riskieren. Wo diejenigen
stehen, die wie der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder oder der franzöische Statspräsident Jaque Chirac
auf der Höhe der IRAK-Krise kurzfristig den Begriff
„multipolar“ benutzten, muss sich noch zeigen.
Unter solchen Voraussetzungen droht sich die schöne
europäische Hausordnung in ihr Gegenteil zu verkehren:
Aus Freiheit für Europa könnte sehr bald Abschottung
gegenüber dem Rest der Welt resultieren. Das Schengener
Abkommen von 1985 und seine Folgevereinbarungen
hinterlassen bereits eine beängstigende Spur: Aus der
Garantie auf Gewährung von Asyl für politisch Verfolgte,
rassisch oder aus anderen Gründen Diskriminierte wird ein
ausgeklügeltes System zur Vermeidung von Asyl durch
Vorverlagerung der Asylentscheidungen in die Grenzländer
der Europäischen Union oder gleich ganz in die
Herkunftsländer von Flüchtlingen. Probestrecke für dieses
Verfahren war der Krieg im Kosovo, als Bosnische
Flüchtlinge gleich vor Ort interniert wurden. Eine
Fortsetzung fand das neue Verfahren in Afghanistan und
kürzlich wieder im IRAK.
Unbemerkt von der Öffentlichkeit entstehen
hässliche Lager in den Randzonen der Europäische Union.
Die tschechische Republik zum Beispiel musste sich bereit
erklären, wenn sie betrittsfähig für die Europäische Union
werden wollte, ein Auffang- und Abschiebelager in
Balkowa zu bauen, in dem die Lebensbedingungen bewusst
auf Abschreckung angelegt sind. Beobachter humanitärer
Organisationen scheuen sich nicht von diesen Lagern als
KZs zu sprechen. Ähnliche Lager entstehen in anderen
Grenzbereichen der erweiterten Europäischen Union. Die
europäische Öffentlichkeit erfährt in der Regel nichts
davon. Die Maßnahmen werden auf europäischen
Innenminister-Konferenzen vereinheitlicht, die sich der
parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die Medien
berichten kaum. Noch schwerer erkennbar sind die
virtuellen Lager in den nicht-europäischen
Herkunftsländern potentieller Flüchtlinge oder
Einwanderer. Diese Länder werden über wirtschaftlichen
Druck zur Kontingentierung ihrer Auswanderer veranlasst,
um nicht zu sagen gezwungen; in der Folge sind die
Grenzen nur für eine Minderheit mit Geld oder mit
Beziehungen offen. Freizügigkeit und Selbstbestimmung,
eines der höchsten Güter im Wertekatalog der
Europäischen Union, bleiben bei diesem Verfahren glatt
auf der Strecke. Eine solche Politik kann auch für die
innere Verfassung Europas auf Dauer nicht ohne
Auswirkungen bleiben. Die Konzentration europäischer
Innenpolitik auf die Abwehr von Einwanderern und die
Bekämpfung des internationalen Terrorismus droht auch
Europa in die Sackgasse eines präventiven
Sicherheitsstaates zu führen, in dem die Rechte der Bürger
das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie stehen.
Regie: Musik
Was also ist Europa? Ein Modell oder eine Festung?
Als Modell für eine plurale Ordnung könnte Europa zeigen,
wie der Verzicht auf militärische Stärke bewusst zum
Ausgangspunkt eines zivilen Integrationsprozesses werden
kann. Es könnte Impulsgeber für den Weg zur Festigung
der pluralen Völkerbeziehungen und kooperativer
Entwicklungsstrategien sein, die sich faktisch im letzten
Jahrhundert herausgebildet haben. Damit läge im Modell
Europa gegenüber der gegenwärtigen Politik der USA eine
echte Alternative, die unter dem Motto: `Europa für alle´
Grundlage zukünftiger Politik Europas und der
Völkergemeinschaft sein könnte. Sie enthielte auch den
richtigen Ansatz zur Lösung der globalen Problems der
Migration. Ein Ausbau Europas als Festung dagegen
provoziert die Gefahr, dass die Ansätze zu einer
multipolaren Ordnung, die real bereits herangewachsen
sind, sich gegen den Willen Europas und der auf dieser
Linie mit ihm verbündeten USA und hinter deren Rücken
durchsetzen, dann aber in scharfen Konflikten, welche die
privilegierte Position des Westens mit Gewalt schwächen.
Das würde auch auf Kosten der zivilen Werte gehen, für die
Europa heute im Gegensatz zu den USA noch steht. Die
Wahl, die wir zu treffen haben, ist also nicht allzu schwer,
wenn das Modell Europa nicht die Vergangenheit, sondern
die Zukunft beschreiben soll.
©
Kai Ehlers
Transformationsforscher und Publizist
www.kai-ehlers.de
i Prof. Dr. Uwe Sielert in „Pädagogik der Vuelfalt, S. 7
Autor: Kai
Europa – Modell oder Festung?
Europa ist ins Gerede gekommen. Vom alten Europa wird gesprochen, vom neuen, von europäischer Schwäche, von notwendiger europäischer Stärke. Der Euro ist dabei, den Dollar zu überholen, aber die europäischen Kernwirtschaften sind in der Krise. Was ist los mit Europa? Ist Europa das Modell für die Gesellschaft von morgen oder ist es ein Überbleibsel von gestern, das sich gegen den Fortschritt der Globalisierung abschottet?
Europäische Intellektuelle streiten: Der französische Philosoph André Glucksmann nannte Europa einen Vogel Strauß, der seinen Kopf vor der Realität in den Sand stecke. Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger kleidete seine Kritik an einem, wie er meint, handlungsunfähigen Europa in das Bekenntnis, der Fall Saddam Husseins habe ein Gefühl des Triumphes bei ihm ausgelöst. Professor Jürgen Habermas erklärte, zugleich mit dem Sieg über den IRAK hätten die USA ihre moralische Autorität eingebüsst.
In der Welt der ehemaligen europäischen Kolonien sind die Sympathien klar verteilt: Europa ist der Traum, die USA sind die Wirklichkeit. „Europa“, sagte kürzlich der Vorsitzende einer städtischen afghanischen Gemeinschaft zu mir – einer von denen, die nach dem Rückzug der Sowjets aus Afghanistan ins Exil gingen und heute von Europa aus um den demokratischen Aufbau Afghanistans bangen: „Europa, das war für uns in Afghanistan, seit ich denken kann, immer der zivile Weg der Entwicklung: Das war Wohlstand, Frieden und Toleranz, Pluralität. Die USA stehen bei uns für das Gegenteil: Sie stehen für Gewalt, für Zerstörung von Tradition und gewachsener Identität. Das Problem mit Europa ist, dass es dabei zuschaut.“ Solche Töne hört man nicht nur aus afghanischem Munde: „Ihr wachst zusammen, wir dagegen zerfallen,“ so schallte es dem europäischen Reisenden zu Hochzeiten der Perestroika auch aus dem Kernland der Transformation, aus Russland entgegen. Und auch in Russland wird klar zwischen Europa und den USA unterschieden.
Ethnische Entmischung, kulturelle Differenzen, wirtschaftliche Ungleichheiten sind in der globalen Umbruchsituation, welche auf die Öffnung der bi-polaren Welt zur Globalisierung folgte, heute weltweit das Problem Nummer eins. Europa verkörpert die Vision einer Ordnung, die über das gegenwärtige Chaos hinausweist – und zwar nicht trotz, sondern wegen seiner Schwäche. Während der Invasion in den IRAK wurde Europa gerade wegen seiner mangelnden Kriegsbereitschaft für viele zur Hoffnung auf einen zivilen Weg aus der Krise.
Ist Europa heute also der Träger des allgemeinen demokratischen Impulses, während die USA das koloniale Erbe des alten Europa in einem neuen Empire globalisieren? Ist Europa der Phönix, der aus der Asche der europäischen Kolonialordnung als Guru einer neuen pluralistischen und kooperativen, kurz: demokratischen Völkergemeinschaft wiedergeboren wird?
Zunächst muss man wohl wissen, was Europa nicht ist: Europa ist keine feststehende Größe, Europa ist ein Prozess: Europa – das war ein mühsamer, immer wieder von Kriegen und Katastrophen zurückgeworfener Aufstieg vom Spätentwickler der Menschheitsgeschichte zur imperialen Vormacht der Welt, Europa – das ist der Fall von dieser Höhe in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts – die Weltkriege, der Faschismus, der Stalinismus – und danach der mühsame Wiederaufstieg zum zivilen Partner der Völkergemeinschaft in einer nachkolonialen Welt.
Europa ist die Kraft der Geschichte, welche die Welt am nachhaltigsten umgestaltet hat, obwohl seine natürlichen Wiegengaben dafür anfangs eher ungeeignet waren: Die zerrissene Insellandschaft zwischen Mittelmeer, Atlantik und den Nordmeeren war noch eine Eis- und Sturmwüste, als andere Teile der Erde bereits erste Kulturen hervorbrachten. Europas Geschichte beginnt erst, als das Eis zurückweicht und Menschen aus wärmeren Gegenden der Erde in die sich erwärmenden Gebiete einwandern. Durch den Golfstrom wurde der europäische Raum dann allerdings zum klimatischen Paradies. Mit anderen Worten: Europa ist nicht erst heute zum Einwanderungsland geworden, die Einwanderung ist der Ursprung seiner Geschichte.
Die Impulse für Europas Entwicklung liegen sämtlich außerhalb des heutigen europäischen Kerngebietes: Aus dem Süden floss der mesopotamische und ägyptische Kulturstrom; aus Zentralasien kamen die Ionier, die Dorer, die Thraker und andere halbnomadische Stämme geritten. In Kleinasien, Sparta, Athen, Griechenland brachten sie ihre Kultur zur Blüte, als im heutigen Europa noch die Bären brüllten Unter Alexander I. drangen sie bis in den persischen Raum vor; die Barbaren des Nordens interessierten sie nicht. Die Römer machten das Mittelmeer zum Binnenraum ihres Imperiums, das sich ebenfalls bis nach Asien erstreckte; die Völker des Nordens grenzten auch sie als Wilde aus der römischen Welt aus. Erst die Teilung in ein ost- und ein weströmisches Reich gegen Ende des vierten Jahrhunderts westlicher Zeitrechnung schuf die Voraussetzungen für den Beginn einer zivilisatorischen Entwicklung des heutigen europäischen Raums.
Richtig los ging es sogar erst mit der noch viel später erfolgten Teilung der christlich-römischen Welt in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinisch-fränkische Entwicklungslinie. Zu dem Zeitpunkt zählte man aber bereits das 8., 9. und 1o. Jahrhundert nach Christi Geburt: Hochkulturen in anderen Teilen der Erde – die mesopotamischen, die asiatischen, die amerikanisch-indianischen – hatten schon mehrere Zyklen hinter sich; die arabisch-islamische Kultur schaute von großer Kultur-Höhe auf die unbehauenen Barbaren im europäischen Norden herunter. Erst in den Kreuzzügen, mit denen es die muslimische Expansion zurückdrängte, entwickelte Europa den Ansatz einer eigenen Identität. Die Kreuzzüge waren die eigentlichen Geburtswehen Europas.
Aber dem Sturm der Mongolen entkam dasselbe Europa ein paar Generationen später dann nur durch einen historischen Zufall: Der mongolische Großkhan starb just zu der Zeit, als die vereinigten Ritterheere des westlichen Europa in der Schlacht bei Liegnitz 1251 von den mongolischen Angreifern vernichtend geschlagen waren. Die europäischen Fürstentümer bis hinein nach Gibraltar lagen offen vor dem mongolischen Heer. Nur durch die Tatsache, daß die feindlichen Heerführer ins ferne Karakorum zurückehren mussten, um bei der Wahl des neuen Khan anwesend zu sein, verdanken die Europäer, daß sie von mongolischer Fremdherrschaft verschont blieben.
Im Treibhaus dieser Enklave am westlichen Rande des mongolischen Großreiches entstand Europa, in einer fränkischen und in einer Moskauer Variante, einer westlichen und einer östlichen also. Verbindendes Element war das Christentum, wenn auch in die byzantinisch-orthodoxe und die lateinische Linie gespalten. Dazu kam die gemeinsame Feindschaft gegen Asiaten und den Islam. Versuche, das in dieser Weise halb vereinte halb geteilte Europa zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden und als Weltreich zu etablieren, blieben jedoch immer wieder erfolglos, wenn nicht gar in Katastrophen endeten: Die Bemühungen Karl V., ein einheitliches christliches Reich zu schaffen, in dem die Sonne nie untergehen sollte, scheiterten an der Reformation. Der darauf folgende 30jährige Krieg, verwüstete Europa nicht nur, sondern zerstückelte es. Die napoleonischen Träume führten in die mörderischen Kriege der europäischen Nationalstaaten.
Mit Hitler kamen die Versuche, Europa gewaltsam zu einen, endgültig zum Abschluss: Der nationalsozialistische Traum von Groß-Europa, das die Welt beherrschen sollte, hinterließ nicht nur Deutschland, sondern weite Teile Europas in Ruinen, entledigte es seiner Kolonien und vertiefte seine historischen Ost-West-Bruchlinien zur Spaltung in zwei getrennte Welten. Das brachte den Kontinent an den Rand seiner Existenz, während der Kampf um die Weltherrschaft an die beiden rivalisierenden neuen Weltmächte USA und UdSSR überging.
Ungeachtet ihrer Zerrissenheit, vielleicht sogar gerade deswegen entwickelte sich aus der Enklave Europas jedoch eine Expansionsdynamik, die ihresgleichen in der Geschichte der Menschheit bis dahin nicht hatte: Die Chinesen, obwohl hochentwickelt, begnügten sich mit der Sicherung des chinesischen Beckens; zu ihren Hochzeiten hatten sie eine Flotte, sogar Ansätze einer Industrie, aber sie schufen damit kein überseeisches Imperium. Die Pharaonen begrenzten ihre Herrschaft auf ihre Verewigung in den Pyramiden. Die Griechen kamen über die Polis und deren philosophische Begründung letztlich nicht hinaus; Alexander I. war bereits ein Usurpator ihrer Geschichte. Die Römer beließen es bei der Ausgrenzung der von ihnen unterworfenen Kulturen aus dem mediterranen Kern des Imperiums, bis sie von ihnen überrannt wurden. Selbst die überaus mobilen Mongolen erschöpften sich nach wenigen Generationen in der Verwaltung des Eroberten. Darüber hinaus gab es bei ihnen keine verbindende Ideologie. Nur der Islam entwickelte zeitweilig eine annähernd vergleichbare Dynamik wie Europa, bis er sich durch Traditionalismus und Fatalismus ausbremste.
In der europäischen Entwicklung dagegen verband sich die Vielfalt und die Enge des europäischen Kontinentes mit dem missionarischen Impuls des Christentums zu einer durchschlagenden und ungebremsten Herrschafts-Ideologie – europäische Missionare trieb es an alle Höfe, in alle Hütten, Zelte und Krale der Welt in dem Bemühen, auch noch die letzte Seele für Gott zu gewinnen; Politiker und Kaufleute aus Europa sorgten dafür, daß die notwendigen Mittel dafür aus den Weiten des Globus herangeholt wurden – im Westen Europas per Schiff über die Ozeane, im Osten zu Pferde quer durch die Weiten der asiatischen Steppen.
Bei allen Differenzen gleichen sich die zwei Seiten des christlichen Abendlandes letztlich in einem: In dem Willen zur Missionierung und kolonialen Unterwerfung der Welt. Gerade weil er nicht aus einem einheitlichen Kommando kam, sondern aus einem vielgliedrigen, differenzierten und widersprüchlichen Prozess hervorging, verwirklichte er sich umso nachhaltiger und totaler; fünfhundert Jahre benötigte Europa für den ersten Schritt: Das reichte von Karl I. bis Christopher Columbus im Westen Europas, also vom Beginn des 9. Jahrhunderts bis zum Jahre 1492, das reichte von der Kiewer Rus bis zum Sieg Iwan III. über die Tataren, also von 882 bis 1480, im europäischen Osten. Aber nach der Entdeckung Amerikas durch Columbus und nach Iwans III. Sieg über die Tataren-Mongolen expandierte der europäische Kolonialismus geradezu explosionsartig, im Westen in seiner maritimen, im Osten in seiner territorialen Variante.
Am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet Europa deshalb vor allem eines: Herrschaft! Im Falle der Russen war es die Selbstherrschaft innerhalb eines Imperiums, im Falle der westlichen Europäer die Fremdherrschaft über Gebiete in Übersee; das Verbindende aber war die Unterwerfung von Kolonien.
Europa, das war bis hinauf zum 1.Weltkrieg der Export des christlich-abendländischen Willens zur Veränderung und zur Beherrschung der Welt. Materiell bedeutete das: Ausbeutung der weltweiten Ressourcen durch die Europäer; ideologisch bedeutete es: Christianisierung oder Unterdrückung traditioneller einheimischer Kulturen bis hin zu deren gezielter Vernichtung. Es war eine rücksichtslose Expansion, die mit brutaler Gewalt durchgesetzt wurde. Produkt dieser Herrschaft war der weltweite Export der Industrialisierung und der damit verbundenen Lebensweise.
Nichts schien diese Expansion aufhalten zu können. Dann aber, im Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert wurde die Welt zu eng für Europas weitere Expansion: In Afghanistan prallten die Landmacht Russland und die Seemacht England aufeinander, in Nordafrika standen sich Briten und Franzosen gegenüber. Als die Deutschen, gestärkt durch die Reichseinigung von 1871, sich anschickten, den Briten mit dem Bau einer eigenen Hochseeflotte die Seehoheit streitig zu machen, war der 1. Weltkrieg praktisch eröffnet. Es bedurfte nur noch des Anlasses. Der Krieg wurde zur Festigung der entstandenen kolonialen Ordnung geführt – was er brachte, war der erste Schritt zur Emanzipation der Kolonien.
Der 2. Weltkrieg vollendete diesen Niedergang der europäischen Kolonialmächte bis zur Unabhängigkeit der meisten Kolonien und der Spaltung Europas. Mit Spaltung war Europa allerdings nicht einfach geografisch geteilt, wie es sich in Stammtisch-Erinnerungen darstellt, also kommunistisch im Osten und kapitalistisch im Westen; es teilte sich vielmehr in einen staatskapitalistischen Osten und einen Westen, der sich auf soziale Marktwirtschaft orientierte.
Die eine Seite Europas war als deren Gegenbild in der anderen enthalten; aber die beiden Seiten waren nicht miteinander vermittelbar, weil jede Seite Vorposten ihres jeweiligen Lagers war. In der Berliner Mauer fand diese Konfrontation ihren schärfsten Ausdruck. Doch die Teilung war nicht nur ein deutscher, sie war ein europäischer Niedergang. Nach 1945 wurde Europa faktisch zum Vorhof der Supermächte USA und UdSSR, Osteuropa und die DDR wurden Satelliten der UDSSR, West-Deutschland und Westeuropa wurden zu Juniorpartnern der USA. Aus Herrenvölkern waren vom Kriege ermüdete mittlere Mächte geworden.
Gerade in Europas Niedergang liegt aber auch der Keim seiner Wiedergeburt als Hoffnungsträger für eine zivile Weltordnung: Der Schock der beiden Weltkriege manifestierte sich am radikalsten in der deutschen Formel: Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und in der Entwicklung West-Deutschlands zum demokratischen Vorzeigestaat der kapitalistischen Welt und Ostdeutschlands zum Aushängeschild des demokratischen Sozialismus. Dass die DDR noch weniger sozialistisch als die BRD musterhaft demokratisch war, ändert nichts an der Tatsache, daß beide Teile Deutschlands die Vorzeigestücke des jeweiligen Systems waren. Mit der Vereinigung beider Hälften 1989 kamen sie zu einem neuen Ganzen zusammen, dessen Charakter, auch wenn die Vereinigung unter der Dominanz des westlichen Teils stattfand, bis heute noch nicht wirklich klar ist.
Die Wiedervereinigung Deutschlands war auch eine Wiedervereinigung Europas. Sie beschloss den schrittweisen Aufstieg West-Europas aus dem Nachkriegschaos zu demokratischer Pluralität. Nie wieder Hegemonie einer europäischen Macht war das treibende Motiv dieses Integrationsprozesses, der 1949 mit der Gründung des Europarates begann, 1957 in die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft überging und zur Europäischen Union führte. Als Michael Gorbatschow mit der Öffnung der Mauer 1989 der Integration Westeuropas die Demokratisierung Osteuropas hinzufügte, wurde Deutschland zum Verbindungsflur des neu entstehenden gesamt-europäischen Hauses. Mit der Osterweiterung der Europäischen Union sind inzwischen weitere neue Mieter in dieses Haus eingezogen.
Ob dieses Haus sich allerdings bis nach Wladiwostok erstreckt, wie manche meinen, darf bezweifelt werden. Zwar ist Russland bis zum Ural zweifellos Teil der europäischen Geschichte und dies begründet eine besondere Beziehung Moskaus zur Europäischen Union, aber Moskaus sibirische und zentralasiatische Territorien gehören heute ebenso wenig zur Europäischen Union wie die ehemaligen und verbliebenen Rest-Kolonien des westlichen Europa. Die Zeiten, in denen sich Europa als Herz einer weltweiten Kolonialordnung definierte, sind endgültig vorbei.
Der Einfluss Europas auf die Welt ist heute nicht mehr durch koloniale Bindungen vermittelt, sondern durch seine wirtschaftlichen Beziehungen. Darüber hinaus liegt Europas Anziehungskraft heute in seiner nach-kolonialen Botschaft. Die Hausordnung in Europas Neubau, die oft zitierte europäische Wertegemeinschaft, die aus den Trümmern des alten imperialen Europa hervorgegangen ist, enthält diesen Anspruch: Danach ist Europa die Überwindung des Nachkriegs-Chaos durch wirtschaftliche und zivile Kooperation in Europa selbst und darüber hinaus. Europa ist ein Beispiel für die Möglichkeit von Integration in schweren Zeiten. Europa ist Vielfalt der Kulturen und Toleranz. Europa ist eine Gesellschaft, die dem Prinzip des Sozialstaates verpflichtet ist. Europa ist Demokratie. Europa ist Mobilität. Europa ist Regionalmacht im globalen Geflecht. Europa ist Katalysator einer neuen pluralen Weltordnung. In Europa steht Pluralismus nicht nur in der Hausordnung, er wird auch philosophisch, sozial- und bildungspolitisch gefördert. Europas Philosophen treten für eine Kultur der Vielfalt ein, die Europäische Union fördert Programme zum Schutz von Minderheiten aller Art, eine „Pädagogik der Vielfalt“ wird an den Universitäten, Lehr- und Bildungsanstalten auch auf alltäglichem Niveau offiziell gefördert. Mit dem Titel „Herausforderung Vielfalt“ ist beispielsweise eine Internationale Konferenz überschrieben, die vom Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein unter Beteiligung kirchlicher Träger im Sommer 2003 durchgeführt wurde. Da geht es um „Fremdheit und Differenz,, um „Pluralisierung und ihre Folgen“, um „Strategien gegen Diskriminierung“, um Perspektiven für die Entwicklung einer „Kultur der Anerkennung“, die nicht nur das Fremde dulden und akzeptieren, sondern das Fremde, das Andere als Bereicherung des Menschseins erleben soll.
In Europa finden die Gegenbewegungen zur Globalisierung, die in den USA zur Zeit entstehen, ihren fruchtbarsten Boden: Die neueste US-Botschaft dieser Art schwappt derzeit unter dem Stichwort „managing diversity“ nach Europa hinüber. Sie ersetzt das Leitwort von der „corporate identity“, das bisher im Management gegolten hat. Bemerkenswert daran ist nicht, daß die USA als Stichwortgeber für Europa fungieren, bemerkenswert ist, dass das Stichwort der „managing diversity“ gerade jetzt aus den USA kommt und gerade jetzt in Europa Fuß fasst, da sich eine konservative US-Regierung anschickt, den gesamten Planeten gewaltsam unifizieren zu wollen.
Selbstbestimmung in einer Welt des bewusst gestalteten Pluralismus, der gegenseitigen Anerkennung und Hilfe der Menschen und der Völker, das ist heute Europas gute Botschaft. Sie geht als Impuls auch in die Globalisierung ein: Multipersonal, multikulturell und im politischen Raum schließlich auch multipolar – das sind die Begriffe, auf die sich diese Botschaft bringen lässt. Sie schaffen Identität in Zeiten der Globalisierung, denn sie helfen dem einzelnen Menschen, gleich welchen Geschlechtes oder Alters, welcher Hautfarbe oder welchen Standes den Ort ihrer Selbstverwirklichung und damit ihrer Würde als Menschen zu finden. Politisch gilt das auch für die Völker. Diese Botschaft ist eine echte Alternative zu den Versuchen der unipolaren militärischen Disziplinierung, die zur Zeit von den USA ausgehen.
Aber Europa hat auch ein anderes Gesicht. „Dieser Trend zur Pluralisierung verläuft nicht geräuschlos und schon gar nicht konfliktfrei“, heißt es z.B. in den Kommentaren der an Vielfalt engagierten schleswig-hosteinischen Pädagogen: „Es geht immer um Eingriffe in die bisherige Verteilung von Macht. Prozesse der Fundamentaldemokratisierung stoßen auf das Bestreben, Privilegien zu verteidigen und jene Machtmittel möglichst unsichtbar zu machen, mit denen sie aufrechterhalten werden. Sie werden auch intrapsychisch so versteckt, dass Angehörige des gesellschaftlichen „Mainstreams“ ihre Privilegien überhaupt nicht mehr wahrnehmen.“.
Die Botschaft der Pluralität, heißt das, kann sich in die Verteidigung der Pluralität gegen tatsächliche oder vermeintliche Gefährdungen von außen verwandeln.
uch dies ist keineswegs neu für Europa: Als Einwanderungsland entstanden, haben die in Europa Ansässigen sich doch immer gegen neue Einwanderer gewehrt: Bereits Rom baute den Limes gegen die Völker des Ostens, gegen die Zuwanderung aus den asiatischen Steppen, gegen die Hunnen Attilas; den Norden Europas befriedete Cäsar durch Unterwerfung, welcher bekanntlich nur ein kleines gallisches Dorf an der Küste der Normandie widerstand… Spätestens mit den Kreuzzügen gräbt sich das Verständnis von Europa als Bollwerk gegen die Ungläubigen tief in dass kollektive europäische Unterbewusstsein ein – in Ost-Europa nicht viel anders als im Westen: Danach waren die Muslime, die Sarazenen, die Türken oder wie immer man sie nannte, gottlose Ungeheuer, welche die Christenheit verschlingen wollten. Vor ihnen galt es die Menschheit zu retten. Die Aufrufe Papst Urban II. und späterer Päpste, zum Töten der Ungläubigen auszuziehen und dafür das ewige Leben zu ernten, lassen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig.
Das ganze frühe Mittelalter, einschließlich der Heldensagen, ist von der Totschlag-Romantik der Kreuzritter geprägt. Auf den Grundsteinen des Kreuzrittertums wurde wenige Generationen später die Festung gegen die Mongolen ausgebaut. Tschingis Chan galt ihren Verteidigern als Kinderfresser, in ihm verschmolzen alle bisherigen Feinde zur asiatischen Gefahr, zur Bedrohung durch das Andere schlechthin, zum Anti-Christ;. Die Kirche erklärte Tschingis Khan zur Geißel Gottes, die Gott zur Prüfung der Menschheit geschickt habe. Besondere Verdienste bei der Verteidigung gegen diese Gefahr nahm dabei Russland für sich in Anspruch, das sich die Rettung des christlichen Abendlandes vor den Mongolen zu gute schrieb, ohne sich daran zu stören, dass dies die historischen Tatsachen zurechtbog, da Europa, wie gesagt, seine „Rettung“ lediglich dem Wechsel der Khane in Karakorum zu verdanken hat. Ungeachtet solcher Feinheiten konnte Joseph Goebbels die Skizzen des von ihm geschaffenen russischen Untermenschen später nach dem mittelalterlichen Klisché von Hunnen und Mongolen fertigen lassen, die sich, krummbeinig, hässlich, mit einem Säbel zwischen den Zähnen in die Mähnen ihrer ebenso hässlichen Ponys klammern, um so das Abendland zu überfluten.
Im Schreckensruf „Die Türken vor Wien“ festigte sich das abendländische Bedrohungs-Syndrom im 17. Jahrhundert weiter. Mit der Niederlage der Türken im Jahre 1683 löste sich zwar der Druck auf West-Europa; für Ost-Europa wurden die Türken und alle mit ihnen verwandten und verbundenen Völker in den folgenden Kriegen zwischen Russland und der Türkei jedoch nicht nur zum wichtigsten Gegner, sondern auch zum inneren Feind. Diese Spur zieht sich bis ins heutige Russland, wo die „Tschornije“, die Schwarzen, das rassistische Hassobjekt für den russisch-orthodoxen christlichen Chauvinismus sind. Auch der gegenwärtige westeuropäische Rassismus ist nicht frei von diesem Klisché.
Im eisernen Vorhang, der West-Europa von Ost-Europa, noch mehr aber den Westen von Asien trennte, fand die Mär vom abendländischen Bollwerk gegen die asiatische Bedrohung seine neuzeitliche Aktualisierung: Im Bild des sowjetischen Kommunismus, der hinter dem eisernen Vorhang nur darauf lauert, das verbliebene christliche Abendland zu verschlucken, verwoben sich die alten Klischés von Attila bis zu den Türken zum kollektiven Wahnbild einer kommunistischen Bedrohung aus dem Osten, für das der US-Präsident Ronald Reagan noch kurz vor Gorbatschows Perestroika-Kurs schließlich die schöne Bezeichnung vom „Reich des Bösen“ erfand, vor dem die USA die Welt beschützen müssten.
Heute ist auch das Böse globalisiert. An die Stelle des eisernen Vorhangs ist die weltweite Front gegen den internationalen Terrorismus getreten. Das „Reich des Bösen“ ist zur asymmetrischen „Achse des Bösen“ geworden. Aber ob asymmetrisch oder nicht, in dem Aufruf gegen die „Achse des Bösen“ treten auch die traditionellen europäischen Bedrohungs-Syndrome in neuer Gestalt wieder hervor, aufgebaut von Ideologen, die den globalen Kampf der Kulturen als Menetekel an die Wand malen und durch einen US-Präsidenten, der zum Kreuzzug gegen das Böse aufruft.
In diesem Kampf wird alles ausgegrenzt und tabuisiert, wodurch sich die christlich-abendländische Wertegemeinschaft bedroht fühlt; das ist, klar gesprochen, alles, was nicht weißhäutig, nicht christlich und nicht hochindustrialisiert ist. Ausnahmen machen die nicht-weißen US-Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch nur, solange sie offizielle Repräsentanten der Supermacht Nr. Eins sind. Ausnahmen machen auch die Menschen und Völker, die man als Bündnispartner braucht, aber nur, solange sie sich gebrauchen lassen. Das erinnert stark an die Praktiken früherer Imperatoren, etwa jene der Römer, welche Germanen, Hunnen und andere so lange hofierten, wie sie als Grenztruppen andere Völker vor den Grenzen aufhielten.
Im Namen von Vielfalt, Liberalität und Selbstbestimmung, heißt das, beginnen sich Europäer heute gegen eben diese Vielfalt, Liberalität und Selbstbestimmung zu wenden. Ausdruck davon sind politische Strömungen wie die Partei des ermordeten Niederländers Pym Fortyn, die mit liberaler Argumentation eine im Kern rassistische Ausgrenzungspolitik vertreten: Wohlfahrt, Vielfalt und Selbstbestimmung ja, lauten ihre Parolen, aber nur für Bürger Europas, nicht für Ausländer – die sollen bleiben, wo sie geboren sind. Ausdruck dieser Wende sind auch Positionen wie die des englischen Premiers Tony Blair, der eher bereit ist, die demokratische Grundsubstanz des europäischen Pluralismus den Zentralisierungsforderungen der USA unterzuordnen, als ein „multipolares Chaos“ zu riskieren. Wo diejenigen stehen, die wie der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder oder der franzöische Statspräsident Jaque Chirac auf der Höhe der IRAK-Krise kurzfristig den Begriff „multipolar“ benutzten, muss sich noch zeigen.
Unter solchen Voraussetzungen droht sich die schöne europäische Hausordnung in ihr Gegenteil zu verkehren: Aus Freiheit für Europa könnte sehr bald Abschottung gegenüber dem Rest der Welt resultieren. Das Schengener Abkommen von 1985 und seine Folgevereinbarungen hinterlassen bereits eine beängstigende Spur: Aus der Garantie auf Gewährung von Asyl für politisch Verfolgte, rassisch oder aus anderen Gründen Diskriminierte wird ein ausgeklügeltes System zur Vermeidung von Asyl durch Vorverlagerung der Asylentscheidungen in die Grenzländer der Europäischen Union oder gleich ganz in die Herkunftsländer von Flüchtlingen. Probestrecke für dieses Verfahren war der Krieg im Kosovo, als Bosnische Flüchtlinge gleich vor Ort interniert wurden. Eine Fortsetzung fand das neue Verfahren in Afghanistan und kürzlich wieder im IRAK.
Unbemerkt von der Öffentlichkeit entstehen hässliche Lager in den Randzonen der Europäische Union. Die tschechische Republik zum Beispiel musste sich bereit erklären, wenn sie betrittsfähig für die Europäische Union werden wollte, ein Auffang- und Abschiebelager in Balkowa zu bauen, in dem die Lebensbedingungen bewusst auf Abschreckung angelegt sind. Beobachter humanitärer Organisationen scheuen sich nicht von diesen Lagern als KZs zu sprechen. Ähnliche Lager entstehen in anderen Grenzbereichen der erweiterten Europäischen Union. Die europäische Öffentlichkeit erfährt in der Regel nichts davon. Die Maßnahmen werden auf europäischen Innenminister-Konferenzen vereinheitlicht, die sich der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Die Medien berichten kaum.
Noch schwerer erkennbar sind die virtuellen Lager in den nicht-europäischen Herkunftsländern potentieller Flüchtlinge oder Einwanderer. Diese Länder werden über wirtschaftlichen Druck zur Kontingentierung ihrer Auswanderer veranlasst, um nicht zu sagen gezwungen; in der Folge sind die Grenzen nur für eine Minderheit mit Geld oder mit Beziehungen offen. Freizügigkeit und Selbstbestimmung, eines der höchsten Güter im Wertekatalog der Europäischen Union, bleiben bei diesem Verfahren glatt auf der Strecke. Eine solche Politik kann auch für die innere Verfassung Europas auf Dauer nicht ohne Auswirkungen bleiben. Die Konzentration europäischer Innenpolitik auf die Abwehr von Einwanderern und die Bekämpfung des internationalen Terrorismus droht auch Europa in die Sackgasse eines präventiven Sicherheitsstaates zu führen, in dem die Rechte der Bürger das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie stehen.
Was also ist Europa? Ein Modell oder eine Festung?
Als Modell für eine plurale Ordnung könnte Europa zeigen, wie der Verzicht auf militärische Stärke bewusst zum Ausgangspunkt eines zivilen Integrationsprozesses werden kann. Es könnte Impulsgeber für den Weg zur Festigung der pluralen Völkerbeziehungen und kooperativer Entwicklungsstrategien sein, die sich faktisch im letzten Jahrhundert herausgebildet haben. Damit läge im Modell Europa gegenüber der gegenwärtigen Politik der USA eine echte Alternative, die unter dem Motto: `Europa für alle´ Grundlage zukünftiger Politik Europas und der Völkergemeinschaft sein könnte. Sie enthielte auch den richtigen Ansatz zur Lösung der globalen Problems der Migration. Ein Ausbau Europas als Festung dagegen provoziert die Gefahr, dass die Ansätze zu einer multipolaren Ordnung, die real bereits herangewachsen sind, sich gegen den Willen Europas und der auf dieser Linie mit ihm verbündeten USA und hinter deren Rücken durchsetzen, dann aber in scharfen Konflikten, welche die privilegierte Position des Westens mit Gewalt schwächen. Das würde auch auf Kosten der zivilen Werte gehen, für die Europa heute im Gegensatz zu den USA noch steht. Die Wahl, die wir zu treffen haben, ist also nicht allzu schwer, wenn das Modell Europa nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft beschreiben soll.
©
Kai Ehlers
Transformationsforscher und Publizist
www.kai-ehlers.de
„Europa, ein Vogel Strauss“? – Anmerkungen zu einem Text von André Glucksmann
Unter der Überschrift „Europa, ein Vogel Strauss“ konnte man vor wenigen Tagen einen Kommentar des französischen Philosophen André Glucksmann zum IRAK-Krieg lesen („Die Welt, 12.3.2003). Darin wirft er der Koalition der „Kriegsgegner“ vor, die Augen vor der Realität des weltweiten Terrors zu verschließen. Der Philosoph geht scharf mit den „Heuchlern“ der „Friedenskoalition“ ins Gericht; er erinnert an den Krieg Wladimir Putins in Tschetschenien, an das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in China, er klagt Joschka Fischer an, seine Lehre „Nie wieder Auschwitz“ vergessen zu haben und bezichtigt Jaques Chirac, mit seiner Inkonsequenz „die Entwaffnung eines berüchtigten Kriegstreibers verhindert“ zu haben.
Die Kritik klingt radikal; zudem spricht ein anerkannter Philosoph. Umso erstaunter ist man, dann eine Kritik zu lesen, in der die Namen der kritisierten Chirac, Schröder, Putin und der Chinesen problemlos durch Bush oder Blair ausgetauscht werden können: Es beginnt mit der Feststellung André Glucksmanns, heute gehe ein Riss durch den Westen – Querelen in der NATO, in der EU, sogar in der UNO. Da es den „Ostblock“ nicht mehr gebe, bedeute das Auflösung der bestehenden Ordnung. Stimmt, aber dann man vermisst man doch die Erkenntnis, dass es sich bei diesem Riss nicht einfach um vermeidbare Bündnis-Querelen handelt, sondern um eine grundlegende Krise der heutigen industriellen Welt, in der das Ende des Sowjet-Imperiums, Russlands und auch Chinas Umbrüche dem Westen nur vorangingen: Nach der Krise des „Ostblocks“ nun die Krise des „Westblocks“. Zu diesem Zusammenhang schweigt der Philosoph.
Zuzustimmen ist der Kritik André Glucksmanns, Chirac, Schröder, Putin und die Chinesen hätten allzu stark polarisiert, als sie „Friedenskoalition“ der „Kriegskoalition“ entgegenstellten. In der Tat, die Polarisierung hat etwas von einer Augenwischerei für die ganz Dummen an sich. Doch wird sie ja nicht nur von einer, sondern von beiden Seiten betrieben. Hat man doch einen George W. Bush gesehen, der seit seinem Amtsantritt, und zwar erkennbar weit genug vor dem 11.9. 2001, seine Verbündeten mit Alleingängen der „einzig verbliebenen Weltmacht“ vor den Kopf stößt und seit dem 11.9. 2001 die Welt in Gute und Böse aufteilt.
Eine Heuchelei ist es zweifellos, auch da ist André Glucksmann zuzustimmen, sich eine „Koalition des Friedens“ zu nennen, wenn man wie Putin in Tschetschenien eine ganze Stadt in Trümmern gelegt habe oder, wie die Chinesen, bis heute kein kritisches Wort über das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens zulasse. Aber gehört Vietnam nicht auch mit in diese Aufzählung, wo die USA versuchten, ein ganzes Volk auszurotten? Die „Friedenskoalition“ trete auf wie leibhaftige Apostel des Friedens, polemisiert Glucksmann. Ja, aber hat nicht George W. Bush den Kreuzzug gegen die „Achse des Bösen“ verkündet?
Hart kritisiert Glucksmann die Veto-Mächte des UNO-Sicherheitsrates: Die fünf ständigen Mitglieder des Rates, erklärt er, benutzen ihr Vetorecht zur verschleierten Durchsetzung eigener Interessen. Richtig, aber warum zählt der Kritiker nur vier der ständigen Mitglieder des Rates auf? Was ist mit dem fünften, den USA? Wofür benutzen die USA den Sicherheitsrat – wenn sie es überhaupt für nötig befinden, ihn zu benutzen? Etwa zur Demokratisierung der UNO?
Ja, der „Klub der fünf“ ist kein Parlament der Völker. Das ist wahr und die Frage Glucksmanns, wieso die Stimme Brasiliens weniger zählen soll als die der Veto-Mächte, ist mehr als berechtigt. Die Veto-Regelung ist ein Überbleibsel aus dem kürzlich zuende gegangenen Jahrhundert. Doch auch in dieser Kritik sind die Namen der „Friedens-“ und der „Kriegskoalition“ wieder austauschbar. Die Newcomer und die Kleinen in der UNO werden weder von der einen noch von der anderen Seite für voll genommen.
Selbstverständlich war es einfacher, wie Herr Glucksmann bemerkt, mit „Ho, ho, Ho Chi Min“ gegen den Vietnamkrieg auf die Straße zu gehen als mit „Kein Krieg in IRAK“ und „Nieder mit Saddam“ gegen einen Krieg im IRAK; Für ein Volk, das für den Sieg im Volkskrieg kämpft, ist eben leichter Partei zunehmen, als für eines, das sich unter einem Diktator duckt. Invasion bleibt deswegen aber immer noch Invasion. Hieraus abzuleiten, Protest gegen eine Invasion sei gleichbedeutend mit einer Unterstützung für die Diktatur, ist schlicht demagogisch.
Auch in der Kritik, wie Glucksmann sagt, an „meinem Freund Joschka Fischer“ muss man dem Philosophen zustimmen: Fischer war für den Krieg im Kosovo – nun ist er gegen den Irak-Krieg; das ist kurzsichtig, inkonsequent, und vielleicht sogar verlogen. Er hätte wissen können, dass die US-Intervention im Kosovo nur der Einstieg der USA in ein weltweites präventives militärisches Krisenprogramm war. Tatsache ist aber auch, dass die öffentliche Kriegserklärung des George W. Bush gegen die „Achse des Bösen“ nicht vor, sondern nach der Intervention im Kosovo, nämlich nach dem 11.9.2001 erfolgte. Heute ist daher deutlicher als damals, dass die Welt bei Durchführung einer solchen Globalpolitik vor der Perspektive einer unabsehbaren Reihe von Abrüstungskriegen unter US-Vorgaben stünde. US-Politik hat sich vor der Welt in rasantem Tempo als krisen- und inzwischen auch kriegstreibend entpuppt. Jetzt wird bereits Syrien bedroht – wer dann? Wie viele Diktatoren dieser Art sollen auf diese Weise beseitigt werden? Deutlicher gefragt: Welche Despoten sollen beseitigt werden und welche nicht? Wer bestimmt das? Mit welchem Ziel und in wessen Namen?
André Glucksmann gibt keine Antworten auf diese Fragen, er trifft nur die Feststellung, dass wir uns heute in einer „radikal neuen Situation“ befänden. Wahr gesprochen!
Aber ist die neue Situation eine Folge des 11. September 2001, wie Glucksmann meint? Nein, das ist sie nicht. Sie ist eine Folge der Auflösung der bi-polaren Welt-Ordnung und des darauf folgenden Versuches der Amerikaner, das, wie ihre Strategen es nennen, „historische Fenster“ zu nutzen, um sich die globale Vorherrschaft zu sichern und mögliche zukünftige Konkurrenten im Keim zu ersticken…
Ungeachtet dessen sieht André Glucksmann die Amerikaner als Opfer, die nun von den Kriegsgegnern als Täter hingestellt würden, wie das ja öfter geschehe. Absichtlich oder unabsichtlich rückt er „die Amerikaner“ damit in die Nähe der Juden, für die diese Aussage üblicherweise getroffen wird. Tatsache ist, dass am 11,9.2001 tausende Menschen Opfer des Terrors wurden. Sie sind zu betrauern. Aber ist Krieg die einzige mögliche Antwort? Darf man da anderer Meinung sein, ohne gleich zu den Bösen, unterschwelligen Anti-Semiten oder den europäischen Sträußen zu gehören, die den Kopf vor der Realität in den Sand stecken? Von welcher Realität ist die Rede? Dazu hören wir von Herrn Glucksmann nichts, außer dass nunmehr eine Verbindung von Bin-Laden-Terrorismus und Pjön Jang-Verdrängung drohe.
Was also will Andé Glucksmann uns sagen? Ihm wäre zuzustimmen, wenn er es dabei beließe, die allgemeine Heuchelei der Mächtigen zu geißeln. Das ist das Vorrecht des Philosophen. Wenn er dabei aber die USA aus seiner Kritik ausnimmt, dann heuchelt auch er. Das wäre sogar noch hinzunehmen; das Heucheln ist gegenwärtig in Mode. Schlimmer noch ist, dass er den Anschein erwecken möchte, als stünde er über den Parteien – ohne auch nur einen einzigen Gedanken vorzubringen, wie die Welt zu einer neuen Ordnung finden könnte, in welcher der Krieg nicht wieder zu einem Mittel der Politik wird, wie von den USA zur Zeit propagiert.
©
Kai Ehlers
Transformationsforscher und Publizist
www.kai-ehlers.de
Wladiwostok – Vorposten Europas in Asien?
O-Ton 1: Bahnhof und Straßenbahn 1.20.00
Regie: O-Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende
hochziehen und mit O-Ton 2 verblenden
Erzähler:
Wladiwostok. Ende der transsibirischen Eisenbahn. Oder ist es ihr Anfang? Wer
hier mit der Bahn ankommt, hat die gewohnten Koordinaten verloren:
Schulgeografie und Landkarte verorten Wladiwostok als asiatischen Ausleger
Russlands am östlichsten Rande des euroasiatischen Kontinents. Man erwartet ein
fremdartiges Stadtbild, mindestens aber Plattenbauten sowjetischen Stils.
Ein Blick aus dem Fenster des einfahrenden Zuges, der erste Schritt auf den
Bahnhofsvorplatz hinaus, der sich direkt ins Stadtzentrum und zum Hafen hin
öffnet, lassen dagegen ein ganz anderes Gefühl aufkommen: Hier wendet sich der
Osten wieder nach Westen; dies ist eine europäische Stadt. Hier ist man näher an
New York, Bordeaux oder Hamburg als an Moskau – zumindest heute, seit
Wladiwostok keine geschlossene Stadt mehr ist, die sie bis 1992 als Kriegshafen
der UdSSR war.
O-Ton 2: Bahnhofsvorplatz und Straßenbahn 0.34.59
Regie: Ton verblenden, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Ende
hochziehen und langsam abblenden
Erzähler:
Schon die Straßenbahn hinterlässt einen anderen Eindruck als die Verkehrsmittel
der Städte Ulan Udé, Tschita, Blagoweschinsk, Chabarowsk; das sind die Zentren
der Verwaltungsbezirke, durch welche die transsibirische Eisenbahn sich entlang
der mongolischen und chinesischen Grenze nach Osten arbeitet. In diesen
Regional-Zentren bestimmen asiatische Gesichter das Bild. Selbst die sibirischen
Millionenstädte Irkutsk und Nowosibirsk sind bunte ethnische Schmelztiegel
gegenüber dem weißen Bild von Wladiwostok. Das ist so, obwohl Japan, Korea
und China direkt vor der Tür von Wladiwostok rund um das japanische Meer
liegen.
Regie: Geräusche der Straßenbahn hochziehen und abblenden
Erzähler:
Im „Archeologischen und ethnografischen Institut für die Völker des Ostens“, in
dem ich forsche und übernachte, wird der erste Eindruck gleich wissenschaftlich
bestätigt. Dr. Wladimir Turajew, Leiter der ethnografischen Abteilung, spezialisiert
auf sibirische Völker im Prozess der Globalisierung, greift zur Beantwortung der
Frage, wie Wladiwostok in die globalen Umbrüche von heute einzuordnen sei,
gleich tief in die historische Truhe: Entschieden grenzt er sich von Ideologien eines
neuen Euro-Asiatismus ab, in denen der alte russische Streit zwischen Slawophilen
und Westlern aus der Mitte des 19. und vom Anfang des 20. Jahrhunderts heute
wieder auflebt. Damals ging es darum, ob Russland zu Asien oder zu Europa
gehöre oder zu keinem von beidem:
O-Ton 3: Dr. Wladimir Turajew, Ethnograph 0.50.00
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Ja nje otnatschus sebja…
„Ich bin kein Freund des Euroa-Asiatismus. Ich denke, das ist für unser Land nicht
gut. Ich bin tief überzeugt davon, dass Russland ein europäisches Land ist. Sicher
hat es viele Elemente des Ostens, Asiens. Aber die heutigen Bedingungen der
Globalisierung bringen Veränderungen ähnlich wie beim Übergang vom 19. auf das
20. Jahrhundert mit sich, in denen sich damals das ganze Leben änderte. In solch
einer Situation muss das Land sich dahin wenden, wo die allgemeine Entwicklung
der Welt hingeht: Das ist heute die westliche Richtung. Wenn Sie es in den
Kategorien unserer alten russischen Auseinandersetzung zwischen Euroasiaten und
Westlern ausdrücken wollen, dann bin ich ein Westler.“
…otnatschus sapdnikom.“
Erzähler:
Mehr noch, setzt Dr. Turajew fort, Wladiwostoks Aufgabe bestehe heute darin,
westliche Kultur gegenüber Japan, Korea, China und der übrigen asiatischen Welt
zu vertreten:
O-Ton 4: Wladimir Turajew 1.13.01
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Wot, dalni wastotschni …
„Die fernöstlichen Verwaltungsbezirke sind in gewissem Sinne Vorposten.
Seinerzeit sagten wir ja, Vorposten des Sozialismus – heute sind sie Vorposten der
westlichen Art zu leben. Wladiwostok war ja von Anfang an eine westliche Stadt
im Osten. Das war mit seiner Gründungsgeschichte verbunden. Hier gab es den
Porta Franka, den französischen Hafen. Es gab den intensivsten kulturellen,
politischen und wirtschaftlichen Austausch nicht nur mit den Ländern Asiens, also
mit Japan, Korea und China, sondern auch mit den Ländern des westlichen Europa.
Und so hat sich Wladiwostok von Anfang an als eine Stadt wirtschaftlicher
Offenheit entwickelt. Über den Hafen stehen wir ständig in Verbindung mit
anderen Ländern, sind immer im Dialog: Die Fischer, die Seeleute. Dadurch hat
sich ein Leben entwickelt, das eher einer westlichen Stadt gleicht. In diesem Sinne
ist sogar eine so europäische Stadt wie meine Geburtsstadt Smolensk traditioneller,
östlicher, asiatischer als Wladiwostok.“
…tschem Wladiwostok.“
Erzähler:
Mit diesem Bogen von Wladiwostok bis nach Smolensk an der polnischen Grenze
hat Dr. Turajew ein russisches Paradoxon formuliert: Russland ist in seinem Herzen
asiatischer als in Asien selbst: Wladiwostok dagegen ist nicht Asien, Wladiwostok
ist Europa in Asien. Wladiwostok ist nicht aus der russischen Ost-Kolonisation
heraus gewachsen, wie die anderen sibirischen und fernöstlichen Städte, die sich
erst entlang der Seidenstraße und dann entlang des sibirischen Industriegürtels nach
Asien gefressen haben. Wladiwostok entstand vom Westen her, aus der Aktivität
der westlichen Kolonialmächte Frankreich, England und auch Deutschland, denen
die russischen Zaren mit der Gründung der Stadt am japanischen Meer im Jahre
1860 einen Riegel vorschoben. 1891 wurde die Stadt und mit ihr der Bezirk
Primorje, was so viel heißt wie Bezirk am Meer, mit dem Bau der Transsibirischen
Eisenbahn an die gesamtrussische Entwicklung angeschlossen; die Fertigstellung
der Bahn 1898 beschleunigte und besiegelte Russlands Eintritt in die Weltpolitik.
Für diese Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sprechen die Historiker
von Russland als „Treibhaus des Kapitalismus“.
Dieser Entstehungsgeschichte verdankt Wladiwostok auch seinen Namen. Auf die
Frage, was unter „Vorposten“ zu verstehen sei, erklärt Professor Plaxen, ein älterer
Kollege Dr. Turajews, der im Institut das Laboratorium für Meinungsforschung
leitet, halb stolz, halb entschuldigend:
O-Ton 5: Prof. Jefgeni Plaxen, Meinungsforscher 0.40.15
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Kak skasats lutsche…
„Wie soll ich es am besten sagen? Wladiwostok irritiert mich immer wegen seines
Namens: Wlade – wostoka, das bedeutet, beherrsche den Osten! Es gibt bei uns
noch eine andere fernöstliche Stadt, auch spät gegründet, Blagoweschinsk am
Amur, direkt an der chinesischen Grenze. Ihr Name bedeutet so viel wie:
Verkündigungsstadt. Dieser Name liegt mir weit näher am Herzen; er wäre auch ein
besserer Name für unsere Stadt am äußersten Ende des russischen Reiches
gewesen. Das wäre auch heute die richtige Losung, unter der man hier vorgehen
sollte.“
…pod etim losungam iti.
Erzähler:
Der Wunsch Prof. Plaxens ist zu verstehen: Die Öffnung Wladiwostoks im Jahre
1991 war keineswegs gleichbedeutend mit Demokratisierung. Mit Hinweis auf die
Frontstadt Wladiwostok und eine angeblich drohende Gelbe Gefahr ertrotzte der
erste Gouverneur Wladiwostoks im neuen Russland, Nostratenko, sich
Sonderrechte von Moskau, konservierte aber zugleich das autoritäre Regime
sowjetischen Typs. Nostratenko ist inzwischen abgetreten, die Stadt öffnet sich.
Zweifellos sei Wladiwostok auch jetzt noch weit entfernt von Wohlstand, Ordnung
und Sauberkeit wie es sie in westlichen Städten, zum Beispiel Hamburg, gebe, so
Professor Plaxen, aber die Richtung sei doch immerhin schon einmal klar:
O-Ton 6: Prof. Jefgeni Plaxen, Meinungsforscher 0.40.23
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„No, Wladiwostoka…
„Ich glaube, dass wir eine Zukunft haben. Die Ergebnisse unserer Umfragen zeigen,
dass die Bevölkerung, auch die Regierung, sich allmählich verändert, dass man sich
zunehmend wieder als Avantgarde begreift, als eine Avantgarde, die russische
Interessen in der asiatisch pazifischen Region schützt; das bedeutet, das sie
europäische Werte schützt. Die Umfragen zeigen auch, dass man die Nase wieder
in den Wind steckt und das dieser Wind in die Richtung der USA, Frankreichs,
Deutschlands und anderer europäischer Staaten weht.“„
…ewropeskich stran.“
Erzähler:
Mit der asiatischen Seite der Stadt, vor der Gouverneur Nostratenko so eindringlich
warnte, konfrontieren uns die Mitarbeiter der chinesischen Abteilung des
Wladiwostoker Institutes für die Völker des Ostens. Mit fünf Mitarbeitern, drei
Männern, zwei Frauen, ist es dessen am besten besetzte Abteilung. Der Einfluss
Chinas auf den fernen Osten und Russland ist das Problem, zu dem das Institut die
umfangreichste Forschung unterhält. Korea oder auch Japan gehen dabei am Rande
mit. Die mongolischen oder turksprachigen Völker Russlands, ganz zu schweigen
von der Mongolei liegen schon gänzlich außerhalb des aktuellen
Forschungsinteresses des Institutes. Der Gigant China drängt alles andere beiseite.
Von Gelber Gefahr will hier indes heute niemand mehr sprechen. Sechs Millionen
Chinesen in Russland? Drohende Übernahme kommunaler Strukturen durch
Einwanderer? Die Zeiten Nostratenkos seien vorbei, heißt es. Unmissverständlich
weist ein Kollege des Teams, Nikolai Wrebschi die Millionen-Zahlen, die von
Moskau aus in die Welt gehen, als Spekulationen zurück:
O-Ton 7: Nikolai Wrebschi, China-Spezialist 0.41.35
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
“No, ja dumaju…
“Nun, ich denke, die Zahl, die Sie genannt haben – das ist reine Fantasie! Sie
können sich auf den Straßen von Wladiwostok überzeugen, dass man dort ziemlich
selten Chinesen trifft. Wenn man welche trifft, handelt es sich in der Regel um eine
Gruppe von Touristen, die kommen, um sich die Stadt anzusehen, sehr kultiviert,
sehr zivilisiert. Hier gibt es überhaupt keine Probleme. Was man da in Moskau
glaubt, dass es hier um Millionen geht, das ist absolut nicht wahr. Es ist eine
fantastische, an den Haaren herbei gezogene Zahl.“
…priviletschenije Ziffre.“
Erzähler:
Auf die Frage, wie er sich das Zustandekommen solcher Zahlen erkläre, fährt
Nicolai Wrebschi fort:
O-Ton 8: Nikolai Wrebschi, China-Spezialist 0.48.37
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
Ransche my gawarili…
“Früher hieß es, wir seien weit weg von Moskau. Ein berühmter sowjetischer
Roman hieß sogar so: „Moskau ist weit“. Jetzt kann man wohl sagen: Moskau ist
weit weg vom fernen Osten. Das hat vermutlich Auswirkungen. Und noch etwas:
Schon seit zehn Jahren zirkulieren diese Zahlen; wenn solche Zahlen erst einmal im
Druck sind, dann führen sie ein Eigenleben. Die Leute schreiben voneinander ab,
aber die Zahlen haben mit der Wirklichkeit absolut nichts zu tun. Man muss
kommen und nachschauen, wie Sie es jetzt tun. Die wirkliche Zahl ist um eine
Stelle kleiner oder sogar noch niedriger. Auf keinen Fall aber derart erschreckend
wie die aus Moskau.“
…kak we Moskwe.“
Erzähler:
Als 1991 das Visa-Regime an den fernöstlichen Grenzübergängen abgeschafft
wurde, berichten die Spezialisten, stieg die Zahl der Einwanderer, übrigens nicht
nur der chinesischen, sprunghaft an. Die meisten statistischen Angaben stammen
aus dieser Zeit, als Gouverneur Nostratenko die Hysterie anheizte. Nach
Wiedereinführung der Visumspflicht an der russisch-chinesischen Grenze 1996
flachte die Kurve der chinesischen Einwanderer erkennbar ab.
Es ist daher nicht die Zahl chinesischer Einwanderer, die das China-Team des
Wladiwostoker Ost-Institutes beunruhigt. Was sie aber doch beunruhigt, ist die Art,
wie die Chinesen im Lande tätig sind.
Alenija Gretina, eine der weiblichen Mitarbeiterinnen des China-Teams,
fühlt sich persönlich betroffen:
O-Ton 9:, Alenija Gretina, China-Forscherin 0.50.19
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzerin:
„Menja otschen bespakoit…
“Mich beunruhigt sehr, dass die natürlichen Ressourcen unseres Bezirkes Primorje
durch illegale Chinesen Schaden nehmen, die regelmäßig die Grenzen
überschreiten, ungeachtet der Grenzkontrollen. Unsere Taiga nimmt Schaden, weil
dort Frösche und seltene Pflanzen weggeschleppt werden; im Meer gibt es
Seegurken, die man kaum noch findet, Naturschutzgebiete plündern sie, wo sie nur
können. Das beunruhigt mich sehr! Ich kenne persönlich Chinesen, die dabei reich
geworden sind und weiter reich werden. Illegal natürlich. Das läuft alles
unreguliert. Damit unser natürlicher Reichtum nicht nur für Chinesen gut wäre,
sondern auch für uns, müssten die Behörden aktiver werden.“
…bolje aktivna.“
Erzähler:
Frau Gretinas Kollegen teilen ihre Befürchtungen. Das Problem liege allerdings
nicht bei den Illegalen, präzisieren sie; die illegale Zuwanderung hätten die
Behörden inzwischen unter Kontrolle. Das Problem liege gerade bei denen, die sich
legal im Land aufhielten:
O-Ton 10: Nikolai Wrebschi, China-Spezialist 0.40.45
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Eti graschdani kak….
„Diese Menschen agieren in der Regel auf offiziellem Boden, sie haben gültige
Dokumente, sie leben hier legal; bei ihnen ist alles in Ordnung. Die Übertretungen
von Gesetzen beginnen dort, wo sie wirtschaftlich aktiv werden: Oft kaufen sie
Holz, Fische und anderes unter der Hand und schaffen es weiter nach China. Darin
liegt das Problem; es ist nicht gelöst und es ist unklar wie es gelöst werden kann.
Das Problem sind also nicht die Chinesen, sondern wir selbst, die wir keine
Regelungen für ihre wirtschaftliche Tätigkeit finden.“
…nawesti parjadok.“
Erzähler:
Es komme noch ein anderer Aspekt hinzu, ergänzt die zweite Kollegin des China-
Teams, Frau Karetina:
O-Ton 11: Galina Karetina, China-Spezialistin 0.30.05
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzerin:
„Jesli…
„Wenn früher der Primorje Bezirk ein Ort für eine ursprüngliche Akkumulation
war, für Kleinhändler, die hier erstes Geld gemacht haben, dann dient er den reich
gewordenen chinesischen Geschäftsleuten inzwischen nur noch als Sprungbrett für
den russischen Markt. Das hörten wir von Chinesen, die groß im Geschäft sind. Für
diese Leute ist es nicht mehr interessant, sich auf russischem Territorium
aufzuhalten; das, wiederum, ist für Russland nicht mehr interessant.“
…Eta problem ssutschustwouit.“
Erzähler:
In dem Fall, erklärt Frau Karetina, flössen nämlich nicht nur die Gewinne illegaler
Geschäfte außer Landes, Russland verliere auch mögliche Steuereinnahmen. Dies
lasse schwere Krisen befürchten. Letztlich aber hänge natürlich alles von der
Entwicklung in China selbst ab. Wider Willen fasziniert schildert die Forscherin
das chinesische Wirtschaftswunder, das sie mit eigenen Augen in den freien Zonen
des chinesischen Nordwestens in den letzten fünfzehn Jahren beobachtet habe:
O-Ton 12: Galina Karetina, China- Spezialistin 2.04.00
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzerin:
„Pajawilis prekrasnie…
„Hervorragende Straßen tauchten auf, ausgezeichnete Brücken, schnelle
Verbindungen, das heißt, modernste Kommunikation. Da kann man fahren, ohne
sich um die Straßen kümmern zu müssen. Das ist natürlich wichtig für die
wirtschaftliche Entwicklung jeder Region. Dann die Produktion von
Konsumgütern: Man trennte sich sehr schnell von den Billigwaren, die anfangs hier
auf den Markt kamen, weil wir sie in unserer Krise hier brauchten. Es tauchten
Waren höherer Qualität auf. Jetzt können die China-Waren sich ohne weiteres mit
denen aus Südkorea oder anderen südasiatischen Ländern messen. Weiter: Private,
kleine Pkws, modernste Produktion, bei der man mit anderen Ländern, z. B.
Deutschland, zusammenarbeitet. Und dann der Baumarkt: Wohnhäuser,
Bürohäuser, Banken, alles mit modernster Technik gebaut, das greift bis in unsere
Region hinein. Auch der Maschinenbau. Alle diese positiven Ergebnisse liegen
direkt vor Augen. Auch die soziale Politik hat sich geändert: Pensionen werden
unabhängig vom Betrieb gezahlt; dann die Lehr-Anstalten: Wenn wir seinerzeit mit
dem Lohn ungefähr gleich lagen, so haben sich die Löhne der wissenschaftlichen
Angestellten in China jetzt sichtlich erhöht. Man kann sich wissenschaftliche
Untersuchungen leisten und hat dabei noch hohe Gehälter – im Unterschied zu
Russland. In diesem Sinne stehen wir noch ziemlich ernsthaft hinten an.“
…otschen silna otstojom.“
Erzähler:
Chinas Weg, wirtschaftliche Freiheit zu geben, aber politisch den Staat fest im Griff
zu halten, habe sich gegenüber der russischen Perestroika eindeutig als der bessere
Weg erwiesen, so Frau Karetina. Andererseits wisse niemand, wohin die
wachsende Arbeitslosigkeit, die schon jetzt über 100 Millionen Menschen betrage,
China noch treiben werde.
„Sie haben die Menschen, wir haben die Ressourcen“, so fassen die drei
Spezialisten des China-Teams ihre Sicht zusammen. 20 Millionen Menschen leben
jenseits des Ural in Sibirien und dem fernen Osten, 140 Millionen sind es in ganz
Russland, Tendenz fallend. Dem stehen 120 Millionen Japaner, 100.000 Millionen
Koreaner, 1,25 Milliarden Chinesen jenseits der Grenze gegenüber.
Den Eindruck, die Zukunft Wladiwostoks hänge allein von Chinas Entwicklung
ab, will das China-team des Ost-Institutes dann aber doch nicht stehen lassen. Auf
die Frage, ob man die Aufgabe Wladiwostoks etwa darin sehe, die bedrohte
russische Ökologie gegen den Ansturm aus China zu verteidigen, antwortet Nikolai
Wrebschi:
O-Ton 13: Nikolai Wrebschi, China-Spezialist 0.34.24
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„My ne protiw Kitajia…
“Wir sind nicht gegen China, wir sind für Russland. Wir exportieren Ressourcen ja
nicht nur nach China und nicht einmal hauptsächlich nach China; das hängt mit den
Besonderheiten der nationalen Verbrauchsstrukturen zusammen. Nehmen wir zum
Beispiel das Holz: Holzhäuser werden vor allem in den USA gebaut und auch in
Japan. Die größten Verbraucher von Holz sind die USA und Japan; danach erst
kommen Südkorea, China und andere Länder.“
…nje tolka Kitai.
Erzähler:
So wird aus dem „Vorposten Europas in Asien“ unversehens ein Vorpostens zum
Schutz der globalen Ressourcen. Mit dieser Sicht konfrontiert, bestätigt Professor
Viktor Larin, der Direktor des Instituts, zunächst kollegial die Angaben seiner
Spezialisten. Larin ist selbst Sinologe und Autor mehrerer Bücher, Mitarbeiter an
der in Moskau herausgegeben Zeitschrift „Diaspora“, die sich mit den Fragen
russischen Migration beschäftigt. Er nennt Zahlen zur Einwanderung von Chinesen,
die sich auf nachprüfbares statistisches Material stützen: 33.000 sind es im Fernen
Osten, ca. 200.000 für den gesamten Raum hinter dem Ural, die meisten von ihnen
als Pendler, die als Händler oder Gastarbeiter über die Grenze kommen. In der Zahl
sind aber auch Touristen und Studierende bereits enthalten. Ganze 600 Menschen
erhielten im fernen Osten seit 1990 die Staatsbürgerschaft. Illegale, so der Direktor,
könnten sich nur halten, solange sie Schmiergelder an die Grenzbehörden und die
Polizei zahlten. Wer nicht zahle, werde abgeschoben. Im Grunde stünden also auch
sie unter Kontrolle und wenn die Behörden wollten, dann könnten sie dem Spuk
von heute auf Morgen ein Ende bereiten.
Aber Direktor Larin nennt nicht nur Zahlen, er nennt auch Gründe, warum die
Zahlen nicht anders sein können:
O-Ton 15: Viktor Larin, Direktor des Ost-Instituts 1.01.36
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Est sdjes dwe…
„Es gibt zwei Hauptgründe, welche die Migration begrenzen, objektive Gründe:
Der erste ist die Kontrolle durch die Ausländerbehörde. Da gibt es jetzt auch eine
Übereinstimmung zwischen russischen und chinesischen Behörden, Grenzbehörden
und Organen der Polizei; sie arbeiten auf diesem Gebiet eng zusammen. Der zweite
Grund ist der begrenzte Markt: Die Chinesen kommen, um hier Geld zu verdienen.
Dafür haben sie zwei Möglichkeiten: Entweder als Arbeitskraft oder im Handel.
Der Markt für die Arbeitskräfte ist begrenzt. Die Nachfrage ist jetzt nicht so sehr
hoch, obwohl, wie bekannt, unsere Leute abwandern. Der Markt der Händler ist
ebenfalls begrenzt. Sie wissen: Acht Millionen im Fernen Osten, 20 in ganz
Sibirien! Mehr Kleinhändler, als heute hier sind, sind einfach nicht möglich, oder?
Wenn jetzt 5000 Händler hier tätig sind – was werden dann 10.0000 machen? Die
haben dann einfach keine Arbeit.“
…nje budit prosta rabota.“
Erzähler:
Direktor Larin bestätigt auch die Angaben seiner China-Abteilung, dass die
chinesischen Einwanderer bei weitem nicht die einzigen seien, die kontrolliert
werden müssen. Gastarbeiter kommen auch aus den ehemaligen sowjetischen
Gebieten Zentralasiens und des Kaukasus. Im Gegensatz zu den chinesischen
Pendlern bleiben sie sogar oft länger.
Kategorisch jedoch weist der Direktor die Vorstellungen zurück, die seine
Mitarbeiter zum Schutz der sibirischen Naturschätze entwickelt haben. Solche
Vorstellungen, erklärt er, glichen bedauerlicherweise den Argumenten, mit denen
seit Jahren der bereits beschlossene Bau von zwei Brücken, eine in
Blagoweschinsk, die andere in Chabarowsk verschleppt werde, die China und
Russland über den Amur hinweg verbinden sollten:
O-Ton 16: Viktor Larin, Direktor des Ost-Instituts 1.07.01
Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Eta mentalität naschich…
„Das ist die Mentalität unserer Beamten. Sie haben Angst. Aber das einfach
dumm: Auch jetzt kann man die Ressourcen wegschaffen; über das Meer, über den
Bezirk Primorje geht das problemlos. Und dann: Es roden doch nicht die Chinesen,
es roden die Russen, es fördern doch nicht die Chinesen das Öl, es fördern die
Russen. Und die Zedernkerne sammeln doch auch nicht die Chinesen, die sammeln
doch unsere Leute! Die Chinesen kaufen, wenn es Nachfrage und Angebote.
Angst vor den Brücken – das ist nur die Rechtfertigung der eigenen Tatenlosigkeit,
der Unfähigkeit zu arbeiten, der Unfähigkeit diese Dinge zu organisieren Die
Entscheidung über unsere ökonomischen Probleme liegt nicht bei den Chinesen,
sondern in unseren eigenen Händen. Nicht die Chinesen haben schuld, dass die
Dinge von Contrabanden dorthin geschafft werden. Sie kaufen, Das ist für sie
profitabel. Aber wir sind es, die verkaufen.“
…my sche prodajom.“
Übersetzer
Richtig, so Direktor Larin, wäre die Überführung des illegalen Verschiebens von
Waren in einen offenen, besteuerten Handel. Die Brücken wären ein Schritt dahin
Das würde der Entwicklung beider Seiten nützen. Bei einer solchen Entwicklung
hätte Russland nur zu gewinnen. Warum sollte Russland sich vor China fürchten?
Fragt der Direktor: Noch nie in der Geschichte habe Russland mit China Krieg
geführt, ganz anders als mit Japan und auch Korea. Vor Japan und Korea fürchte
man sich auch nicht, warum also vor China? Auch in Zeiten der Globalisierung, so
der Direktor, werde sich diese Beziehung zu China kaum ändern.
Den Grund dafür sieht er in dem, was er die chinesische Idee nennt:
O-Ton 17: Viktor Larin, Direktor des Ost-Instituts 0.54.14
Regie: Regie: Kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, am Schluss hochziehen
Übersetzer:
„Kakaja kitaski swjer …
„Was ist die chinesische Idee? Es ist Vorstellung einer einheitlichen Nation. Für die
Chinesen ist nicht das Territorium wichtig, wichtig ist ein einheitlicher chinesischer
Ideenraum: Das große China. Aber das Große China – das ist nicht die territoriale
Ausdehnung; das eigentliche China waren immer die südlichen Provinzen, nicht
Sinkiang, nicht die Mandschurei, nicht Tibet. Diese Gebiete waren immer Vasallen-
Räume. Die Chinesen haben dort nie Verwaltungen aufgebaut. Es reichte Ihnen,
alle fünf Jahre ein kleines Geschenk zu bekommen. Eine territoriale chinesische
Expansion ist deshalb kaum zu erwarten. Chinesen haben immer anders gewirkt:
durch kulturelle Expansion. Das ist ihre Waffe, die ist erfolgreich.“
…uspeschno.“
Erzähler:
Mit dieser Sicht hat Direktor Larin ausgesprochen, was der eigentliche Inhalt der
Losung vom „Vorposten Europas“ für Wladiwostok heute ist: Der kulturellen
Expansion Chinas eine ebenbürtige Kraft entgegen zu setzen. Dies ist in seinen
Augen, wie in den Augen der Mehrheit der Bevölkerung von Wladiwostok das alte
Europa, das wie das alte China heute über die Kraft verfüge, sich kulturell zu
erneuern. Daraus, so hoffen sie, werde etwas Neues entstehen. Der Hauptkonflikt
jedoch, der das nächste Jahrhundert bestimmen werde, davon ist Larin ebenso
überzeugt wie die Mehrheit der fernöstlichen Intellektuellen, ist der zwischen China
und den USA. „YinYan“, sagt Direktor Larin mit knapper Selbstironie, „es gibt
keinen leeren Raum.“ Wo vorher die Sowjetunion war, fülle jetzt China den Raum
aus. Mit dieser Sicht und nicht zuletzt mit deren klassisch-chinesischer
Formulierung ist der Direktor des Wladiwostoker Ost-Institutes selbst bereits ein
Produkt der von ihm prognostizierten neuen Begegnung von Europa und China.
©
Kai Ehlers
Transformationsforscher und Publizist
www.kai-ehlers.de
Hintergrundtext: Modell Kasan
Islam in Russland – Front im Krieg der Kulturen oder Ansatz für eine Alternative?
Der andauernde Terror in Tschetschenien lässt die Befürchtung aufkommen, dass Russland zur Front im Krieg der Kulturen aufrücken könnte. Im schwarzen Loch Tschetschenien konzentrieren sich fundamentalistische Energien, christlich orthodoxe ebenso wie islamistische, rassistische und nationalistische.
Tschetschenien ist zudem nur ein Teil des Problems, soweit es die Beziehung von christlicher und muslimischer Welt betrifft: Ca. 20 Millionen Muslime leben heute in der russischen Föderation, das sind 15% der Bevölkerung des Landes. Gut zehn Millionen dieser Muslime leben in einer Enklave an der Wolga; vier von sechs autonomen Republiken sind dort muslimisch geprägt: Das sind – ihrer Bedeutung nach – Tatarsatan, Baschkortastan, Utmurtien, Mordawien. Dazu kommt El Mari mit einem hohen Anteil muslimischer Einwohner und die tschuwaschische Republik. Die Tschuwaschen sind zwar christlich-orthodox orientiert, sofern sie nicht naturreligiösen Gebräuchen anhängen, ethnisch jedoch mit den Tataren verwandt.
Die Mehrheit der im Wolga-Raum lebenden muslimischen Gläubigen gehört nicht-slawischen Völkern an, die im Zuge der Völkerwanderungen mit den Hunnen, später mit den Mongolen als Nomaden aus dem Osten kamen und dann im Wolga- Don- und Donauraum sesshaft wurden. Doch weder die inneren noch die äußeren Grenzen Russlands decken sich mit der religiösen Landkarte. und diese wiederum nicht mit der ethnischen.
Die restlichen zehn Millionen Muslime sind über die ganze russische Föderation verstreut. Die Enklave an der Wolga, insbesondere Tatarstan mit seiner Hauptstadt Kasan, ist ihre Orientierung. Zwischen dieser Enklave und den kaukasichen Muslimen wie auch denen Zentralasiens – insbesondere Usbekistans – bestehen direkte Verbindungen. Die Mehrheit der muslimischen Geistlichen, die heute in Zentralrussland lehren, kennen sich noch aus der gemeinsamen Studienzeit an der Islamischen Universität, die sie zu Sowjetzeiten in Usbekistan besucht haben. Den Tschetschenen, auch wenn man unterschiedlichen muslimischen Konfessionen angehört, fühlt man sich solidarisch verbunden.
So ragt ein Dreieck islamischen Einflusses, das seine Basis in Zentralasien und dem Kaukasus hat, mit seiner Spitze direkt ins Herz des orthodoxen Russland hinein. Türkei, Pakistan, Iran und nicht zuletzt Saudi-Arabien wetteifern um Einfluß auf den wieder entstehenden russischen Islam. Dies alles zusammen ist eine Gemenge-Lage, die eine Konfrontation zwischen dem Restaurations-Anspruch des russischen-orthodoxen Zentralismus und der Ausrufung eines islamischen Gottesstaates, wie man sie gegenwärtig in Tschetschenien erleben muss, als nahezu zwingend erscheinen lässt. Hinzu kommt schließlich noch die Tatsache, dass die russisch-orthodox orientierte Bevölkerung stärker vom Bevölkerungsrückgang Russlands betroffen ist als die muslimische.
Umso erstaunter muss man sein, in Kasan auf das genaue Gegenteil einer islamischen Bedrohung zu stoßen, nämlich auf ein exemplarisches Modell für die Koexistenz von orthodoxer russischer Kirche und aufgeklärtem, nach europäischem Verständnis modernisiertem Islam auf der Basis eines gleichberechtigten Zusammenlebens von russisch-slawischer und tatarisch-mongolischer Bevölkerung.
Kasan, das sich zur Zeit auf seinen tausendjährigen Geburtstag vorbereitet, ist traditionell das Zentrum des russischen, genauer des euro-asiatischen Islam. Gegründet 1005, wurde die Stadt nach der Vernichtung des bolgarischen Wolgareiches 1237, der anschließenden Niederlage der russischen Fürstentümer und schließlich des Falles von Kiew im Jahre 1247 zur nördlichen Residenz der Goldenen Horde, sehr bald zu einem eigenen Chanat.
Seit dieser Zeit ist Kasan nicht nur Hauptstadt des Wolgaraumes, sondern auch Zentrum des Islam in Eurasien. Nach der Eroberung Kasans durch die Truppen Iwans des IV. im Jahre 1552 wandelte es sich zum Zentrum der islamischen Enklave Russlands. Rund vier Millionen Muslime leben heute allein in dieser Republik.
Aber nicht von Anfang an war Kasan ein Modell für Koexistenz zwischen der russischen Orthodoxie und dem Islam: Iwan IV. und nach ihm die ersten Romanows, die seine Politik der Ostkolonisation und des Kampfes gegen die Tataren fortsetzten, versuchten den Islam im Herzen der neuen russischen Gebiete an der Wolga auszurotten. Erst Katharina II. erkannte, dass eine dauerhafte Unterdrückung des Islam immer neue Revolten im Lande hervorbringen musste, in denen sich soziale, ethnische und religiöse Problem in explosiver Weise verbanden. So beendete sie den Aufstand des Jemeljan Pugatschow von 1773 – 1775 nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern sie erließ eine Reihe von Ukasen, die den Islam in Russland legalisierten. Sie gestattete der islamischen Geistlichkeit den Aufbau einer eigenen Verwaltung, förderte den Aufbau von Moscheen und mit den Moschen verbundenen Schulen und Institutionen, kurz, seit dieser Zeit leben orthodoxe Kirche und Islam in Tatarstan, Kasan, gleichberechtigt nebeneinander – wohlgemerkt: Nicht in Russland, sondern in Tatarstan und – in schwächerem Maße – auch in den an Tatarstan angrenzenden muslimischen Ländern. Unter diesen Bedingungen bildete sich eine ethnisch-religiöse, eine christlich-orthodox-muslimische, eine slawisch-tatarische Mischkultur heraus, in der muslimische Tataren und slawische Christen paritätisch miteinander leben.
Damit wurde Kasan zum Orientierungspunkt nicht-russischer, nicht-christlich-orthodoxer Völker des russischen Imperiums. Sowohl in der Revolution von 1917, als auch bei Einsetzen der Perestroika Ende der 80er des vorigen Jahrhunderts stand Tatarsatan an der Spitze der innerrussischen Bewegungen für Souveränität. Heute ist die Stadt das Zentrum der neu-föderalen Bestrebungen Russlands, in dem sich die Hoffnungen religiöser, ethnischer wie kultureller Minderheiten Russlands treffen. Das nebeneinander der Mutter-Gottes-Kirche und der ganz aus eigenen Mitteln restaurierten neuen Zentral-Moschee im Kreml Kasan, direkt gegenüber dem Regierungsgebäude ist das Symbol dieses Selbstverständnisses der Regierung und Bevölkerung von Kasan/Tatarsatan. Das heutige Kasan ist ein Gegenentwurf zu Moskau – die heimliche dritte Hauptstadt Russlands. Neben Moskau als politischem Zentrum und St. Petersburg als Fenster zum Westen repräsentiert Kasan das euro-asiatische Russland, in dem sich Westen und Osten, Christentum und Islam, Slawen und asiatische Völker miteinander verbinden.
Forscht man nach dem Wesen dieser Koexistenz, trifft man auf den in West-Europa bisher weithin unbekannten Begriff des Jadidismus. Der Begriff leitet sich aus dem tatarischen Wort „jadid“ her, was so viel heißt wie neu; den Gegensatz dazu bildet „kad“, althergebracht. Strömungen, die einem traditionellen Islam das Wort reden, werden dementsprechend unter dem Begriff „Kadismus“ zusammengefasst. Bei Kasans regierenden Tataren, allen voran dem Präsidenten Schamijew, ebenso wie bei seinem engsten politischen Berater Dr. Raphael Chakimow genießt der Jadidismus den Rang einer Staatsideologie.
Dr. Chamikow spricht von einem aufgeklärten, einem reformierten, einem europäisch orientierten Islam. Die persönliche Beziehung zu Allah stehe vor den kollektiven Ritualen. „Im 18. Jahrhundert“, erklärt Dr. Chakimow, „gab es hier eine Reformation des Islam.“. Dr. Chakimow meint damit die Reformen der Katharia II., die deswegen in der tatarischen Bevölkerung bis heute zärtlich Baba, Großmütterchen, Katharina genannt werde.
Man könne den Jadidismus nicht direkt mit dem Lutheranismus vergleichen, aber eine Reformation sei es zweifellos: „Unsere Wissenschaftler stellten die Frage, warum der Osten gegenüber dem Westen zurückgeblieben sei. Die Antwort war, dass er gewissen Traditionen der Autorität gefolgt sei, auf arabisch ´taklid`; das eben hat den Islam geschwächt. Der ursprüngliche Islam ist dagegen auf kritisches Denken gerichtet. Jeder sollte nachdenken, jeder sollte selbst abwägen. Aber dann kam die Tradition auf, Autoritäten zu folgen, und der Islam wurde zu einer unumstößlichen Vorschrift.
Unsere Reformatoren sagten dann, man müsse sich an das kritische Denken wenden. Um den Koran zu lesen, muss der Mensch gebildet sein. Von daher folgt als Erstes, dass jeder Muslim eine gute Bildung haben muss. Also muss man neue Schulen bauen, nach europäischem Standart. Das war die erste Etappe. Das Zweite war, dass im tatarischen Islam, im Jadidismus, die Religion eine persönliche Angelegenheit ist. Da ist Allah – und da bist du; zwischen euch ist kein Advokat. Da ist kein Mullah und kein Imam: Du alleine sprichst mit Allah. Du sagst guten Tag, er antwortet. Hier hat die Obschtschina, die Gemeinde, nichts zu sagen. Also, der tatarische Islam ist eine persönliche Angelegenheit. Die Moschee ist natürlich ein Ort, wo man beten kann, aber vor allem ist sie ein Zentrum der Bildung. Ansonsten gehst du in die Moschee wann und wo du willst. Niemand kann mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe – fünf mal zu Boden oder nicht fünf mal? Soll ich meinen Kopf beugen oder nicht? Das ist meine Sache. Das unterscheidet den Tataren stark von anderen moslemischen Völkern.
Das war schon vor der sowjetischen Zeit. „Al Jadid“ ist die Bezeichnung für diese Reform: Andere Beziehung zu Frauen; Frauen sind den Männern in allem gleich; tolerante Beziehung zu anderen Religionen. Hauptsache du bist gläubig und tust gute Dinge. Allah ist für alle gut. In einem allerdings unterscheidet sich der Jadidismus vom Protestantismus: Durch den Protestantismus hat sich auch im Glauben selbst viel geändert, der Jadidismus kehrt nur einfach zum Koran zurück. Er wendet sich von der Prophetenvermittlung ab, der Autoritätsgläubigkeit. Für den Jadidismus ist die einzige Autorität der Koran selbst.“
Man könnte argwöhnen, der Jadidismus sei nur eine Erfindung der Politiker, um die ethnischen und religiösen Probleme der Republik ideologisch in den Griff zu bekommen. Angesichts der Lücke, die der Zusammenbruch der atheistischen Staatsideologie in Russland hinterlässt, wäre das nicht verwunderlich und nicht einmal zu kritisieren.
Kasans muslimische Geistlichkeit unterstützt jedoch nicht nur den Kurs des Präsidenten, sie hält nicht nur engste Kontakte zu Dr. Chakímow als aktivem Vertreter des Jadidismus im Kasaner Kreml, sie sieht sich auch selbst ganz und gar in dieser Tradition.
Und sie versteht den Jadidismus als ein Modell für das Zusammenleben von Christen und Moslems: „Kasan ist heute ein Beispiel“, erklärt Valjulla M. Yaghupow, Assistent des obersten Mufti im Kasaner geistlichen muslimischen Zentrum“, denn ungeachtet der Tatsache, dass hier 50% Christen und 50% Moslems leben, hat es bisher keine blutigen Zusammenstöße in religiösen Fragen gegeben. Das sagt schon viel aus. Selten sind die Länder in der Welt, wo es ein solches Verhältnis von Christen und Moslems gibt und wo kein Blut vergossen wird. Erinnern Sie sich an Bosnien usw. Kaum irgendwo außer bei uns gelingt es, diese Fragen friedlich zu lösen? Deshalb sind wir ein Modell und werden eins sein. Überhaupt haben wir hier eine einzigartige Situation in Bezug auf die Veränderungen, welche die islamische Welt heute in Berührung mit den Weltproblemen bringen. Für diese Prozesse kann der Islam, der hier bei uns besteht, der Jadidismus, zu einer allgemeinen Plattform werden, weil wir eine sehr reiche Erfahrung im Zusammenleben mit Christen haben. Das ist jetzt aktuell.“
Wie die politische Fühung spricht auch die muslimische Geistlichkeit von „Euro-Islam“, „das ist Alltags-Islam unter den Bedingungen einer christlichen Zivilisation, der heutigen Zivilisation, die Anpassung des orthodoxen Islam an die Bedingungen der heutigen Welt, das heißt auch, Alltagsbedingungen des Islam heute generell.“ Für dessen Entwicklung bestünden unter den Bedingungen der nach-sowjetischen Aufarbeitung besonders günstige Voraussetzungen. Doch, schränkt er ein, sei dies nicht gleichzusetzen mit einer Modernisierung des Islam.
Der Islam bestehe aus drei Teilen, von denen aber üblicherweise nur zwei bekannt seien, erklären Kasaner Religionsforscher wie Rafik Muhamedschin diesen Widerspruch, der Koran, das Wort Allahs, als eigentlicher Kern des Islam und die Scharia, der Alltag, der sich auf Grundlage des Islam herausbilde.
Ein drittes jedoch werde in der Regel vergessen, was hinzutrat, als viele verschiedene Völker zum Islam übergingen, nämlich: „urf adak“, die Einrichtung der „abweichenden Rechte“, die sich aus der besonderen Lage der jeweiligen Völker ergeben.
Wenn sie dem Islam nicht widersprächen, so Rafik Muhammedschin, könne man sie in Anspruch nehmen. In diesem Sinne existiere auch im Islam schon lange der Liberalismus, der zwischen Religion, Staat und jeweiliger Gesellschaftsform differenziere. Wenn der Koran und die Scharia als Kanon zu verstehen seien, die prinzipiell nicht in Frage zu stellen sind, so unterstreiche „urf adak“, der Teil der „abweichenden Rechte“ die Besonderheiten der verschiedenen Regionen – Iran oder Mittleres Asien, die Tataren, Dagestan, Kaukasus – und selbstverständlich auch der verschiedenen Zeiten.
In diesem Verständnis sind sich Vertreter des Jadidismus mit denen des Kadismus im Grundsätzlichen einig; die Unterschiede zwischen ihnen liegen im Detail. Damit steht die große Mehrheit der tatarischen Muslime und mit ihnen die Mehrheit aller Muslime Russlands bei aller Solidarität mit den Verfolgten Glaubensbrüdern und –schwestern in prinzipiellem Widerspruch zu den Fundamentalisten arabischen Herkommens in Tschetschenien, die „urf adak“ als Verunreinigung des wahren Islam ablehnen und den Koran als Grundlage eines Gottesstaates begreifen. Die Verbreitung solcher Vorstellungen im russischen Islam ist jedoch marginal. Ebenso marginal sind Strömungen wie die der Sufis auf der anderen Seite des Spektrums, die überhaupt keine Beziehung zwischen Religion, Staat und Gesellschaft herstellen wollen.
Differenzen unter den Muslimen Russlands betreffen heute eher die Frage in welcher Form sich die islamische Kirche organisiert, als Teil der russischen Zentrale oder als dezentrale Kraft von unten. Diese Frage ist bisher nicht entschieden. Zur Zeit gibt es zwei zentrale Vertretungen des Islam, die eine im alten Stil von einem „Obersten Mufti der russischen Föderation“ aus Moskau geleitet, die andere aus den muslimischen Gemeinden Tatarstans und anderer Republiken Russlands demokratisch gewählt. Beide existieren nebeneinander. Angesichts der Tatsache, dass außerhalb Tatarstans von gleichen Rechten für die muslimische und die orthodox-christliche Kirche nicht die Rede sein kann, ist die demokratische Variante, die sich mit einer Orientierung nach Europa verbindet, das attraktivere Modell.
Mehr zum Thema in: Themenheft 12: Modell Kasan? Modell Kasan
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550
Ortsbestimmung… Betrachtungen zur neuen Unordnung unserer Welt
Der 11.9.2001 gilt inzwischen als historisches Fanal: Nichts werde mehr sein, wie es war, heißt es. Von neuer Zeitrechnung ist die Rede, von neuem Bewusstsein. Real hat sich allerdings bisher nichts Prinzipielles geändert, außer, dass nach den neuen Sicherheitsdoktrinen der USA Krieg in Zukunft wieder möglich sein soll. Auch der Terrorismus ist keine neue Erscheinung; es gab ihn vor dem Anschlag vom 11.9. 2001 und es gibt ihn jetzt. Krieg und Terror sind bedauerlicherweise ständige Begleiter der Geschichte. Es ist nur so: Wir – die Europäer und auch wir Deutschen – hatten uns daran gewöhnt, die Aufteilung der Welt in zwei Lager nach 1945 für normal und das Gleichgewicht des Schreckens für Frieden zu halten. Doch diese Ordnung ist schon lange passe´. Heute regt sich weltweit Widerstand gegen die Vorherrschaft der USA, gegen den westlich dominierten industriellen Spät-Kolonialismus unter Führung der Amerikaner. Die Anschläge vom 11.9.2001 waren bereits ein Ergebnis, nicht der Ausgangspunkt dieser Entwicklung.
Regie: Musik
Erste Anzeichen des Umbruchs zeigten sich schon mit der Krise der Sowjetunion. Das konnte man lange auf den “kranken Sozialismus “ schieben. Die kapitalistische Welt erschien als die eigentliche Gewinnerin; der Westen fühlte sich als Sieger. Der Japan-Amerikaner Francis Fukujama verstieg sich sogar dazu, den Sieg der USA als das “Ende der Geschichte” zu interpretieren. Inzwischen warnt er generell vor dem Ende jeglicher Entwicklung. Samuel Huntington dagegen erfand mit der islamischen Bedrohung einen neuen Feind. Tatsächlich hat der 11.9. 2001 lediglich offenbart, dass auch der Westen in der Krise ist. Die Supermacht USA hat sich übernommen. Je drohender sie heute in der Welt auftritt, umso klarer wird ihre innere Schwäche.
Die neuen Verhältnisse, die jetzt zum Durchbruch drängen, haben sich im Gewand der alten Ordnung entwickelt. Die bipolare Teilung der Welt in Ost und West war schon seit 1964, als sich das kommunistische Lager in die chinesische und die sowjetische Linie aufspaltete, eigentlich gar keine zweiseitige mehr. Im Grunde gab es bereits eine Dreiteilung: In der Konkurrenz zwischen den Sowjets und dem Westen spielte China zunehmend den Part des lachenden Dritten. Seit Deng Hsiao Ping 1978 die Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft einleitete, beschleunigte sich diese Entwicklung. Heute ist China das Land mit dem am schnellsten wachsenden Bruttosozialprodukt der Welt, das sich anschickt, als Führer des asiatischen Entwicklungsraums zur neuen Weltmacht aufzusteigen.
Regie – Musik
Als Kernpunkt der heutigen Entwicklung ist festzuhalten: Die gegenwärtige globale Krise, die sich in dem von Amerika propagierten Krieg gegen den Terrorismus ausdrückt, ist eine Wachstumskrise. Sie markiert das Ende der Hegemonie der westlich geprägten Zivilisation vor dem Hintergrund eines globalen Entwicklungsdruckes der früheren Kolonien, die heute selbstständige Staaten sind und das Weltgeschehen mitgestalten wollen. Die Bedingungen für einen grundlegenden Wandel der nachkolonialen Verhältnisse haben sich verstärkt und drängen nach Verwirklichung. Das heißt, sie drängen auf Beseitigung der spät-kolonialen Ordnung, so wie seinerzeit die bürgerlichen Kräfte Frankreichs und Europas auf eine Beseitigung der Feudalordnung drängten. Die Frage ist, ob die herrschenden Kräfte, die sich eben zu neuer imperialer Größe aufschwingen, diese Umwandlung zulassen oder ob sie versuchen, sie zu verhindern.
Die jüngste Entwicklung lässt mehrere Phasen erkennen:
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion brach die Krise am schwächsten Glied der Kette der nach westlichem Muster entwickelten Industriestaaten aus. Dazu ist anzumerken: Natürlich war die Sowjetunion niemals, so wenig wie Russland, bloß ein Bestandteil Europas. Russland liegt zwischen Asien und Europa und definierte sich immer zwischen diesen Polen. Das ist heute – aller Globalisierung zum Trotz – nicht anders als vor tausend Jahren.
Die Industrialisierung Russlands, insbesondere die Zwangsindustrialisierung nach der Oktoberrevolution von 1917, vollzog sich aber nach europäisch-amerikanischen Vorgaben – als verspätete Industrialisierung unter sozialistischen Parolen, als Staatskapitalismus sowjetischen Typs. Auch als Kolonialmacht war Russland Bestandteil der europäischen Geschichte. Allerdings unterscheidet sich der russische Kolonialismus in wesentlichen Zügen vom zentraleuropäischen: Moskau kolonisierte territorial und integrativ statt maritim und aggressiv wie West-Europa und Amerika. In Russland verbanden sich Kernland und Kolonien zu einem vielgliedrigen Ganzen, während im europäischen Kolonialraum ebenso wie im amerikanischen die Trennung zwischen Mutterland und Kolonie immer gewahrt blieb.
Was so entstand, ist ein Industriegigant nach dem Muster des wissenschaftlich-technischen Weltbild des Westens – aber zu großen Teilen auf asiatischem Boden und mit asiatischen Methoden. Seit Mitte der siebziger Jahre wurde deutlich, dass dieser Gigant die Grenzen seiner Expansionsfähigkeit erreicht hatte – wirtschaftlich und politisch. Die Planwirtschaft und –Tonnenideologie der sowjetischen Zwangs-Industrialisierung kam mit Eintreten der Computerrevolution an ihre Grenzen. Denn nun wurde der Übergang zu qualitativer und intensiver Produktion notwendig. Politisch markiert das Desaster von Afghanistan das Ende der russisch-sowjetischen Expansion. Weiter war der Ballon des russisch-sowjetischen Imperiums nicht mehr aufblasbar. Im Prinzip waren es somit keine speziellen “sozialistischen” Probleme, an denen die Krise ausbrach, es war die Notwendigkeit, von expansiven Entwicklungsmodellen zu intensiven, qualitativen überzugehen. Der sozialistische Überbau hat diese Probleme lediglich zugespitzt. Die sowjetische Nomenklatura unter Michail Gorbatschow erkannte die Unumgänglichkeit dieser Tatsachen und ließ sich auf einen Transformationsprozess ein. Der Slogan von der gewachsenen Bedeutung des “Faktors Mensch” gehört hierhin. Dezentralisierung, Demokratisierung, Befreiung der persönlichen Initiative sind die Stichworte, an deren Umsetzung Russland und andere nachsowjetische Staaten seitdem laborieren.
Mehr als fünfzehn Jahre lang galt angesichts dieser Entwicklung zunächst die Sowjetunion und dann Russland als der “kranke Mann” des Globus. Der Westen gefiel sich in der Rolle des Arztes, der Rezepte verschreibt: Aber die neo-liberale Gewaltkur, die Boris Jelzin zusammen mit dem IWF, der Weltbank und anderen seinem eigenen Lande aufdrängte, erwies sich als Krankheit, welche die USA – als die Führungsmacht dieses Prozesses – in den letzten Jahren zunehmend selbst in die Krise brachte. Der Wahlkampf zwischen George W. Busch und Al Gore Anfang 2001 stand bereits vollkommen im Schatten dieser Krise. Die Politik, die Busch vor dem 11. 9.2001 betrieb: Zinssenkung, außenpolitischer Protektionismus, Rückzug Amerikas aus internationalen Verpflichtungen – war ein Krisenmanagement, das von Bankrotterklärungen und Firmenzusammenbrüchen begleitet wurde. Gleich nach dem 11.9.2001 ist die US-Administration zu einer global angelegten Notstandsbewirtschaftung und -Politik übergegangen : Milliarden für das Militär, Zurückfahren der Sozialpolitik, Schutzzölle für die US-Stahlindustrie. Einen günstigeren Anlass für diesen Kurs als den Anschlag auf das World Trade Center vom 11.9. 2001 hätte niemand erfinden können.
Man beachte aber den Unterschied: Anders als die Sowjets, die auf die wirtschaftliche Krise und die Niederlage in Afghanistan mit der Überführung der expansiven in eine intensive Entwicklung antworteten, nutzten die US-Amerikaner die Gelegenheit zu weiterer Expansion: Von der sogenannten “allein übriggebliebenen Weltmacht” schritten sie nun zum Anspruch auf die globale Führungsmacht, die ihren Einfluss jetzt in das einzige von ihr bis dahin noch nicht beherrschte Gebiet ausdehnt : nämlich nach Zentralasien. Damit ist die Krise, die am schwächsten Glied losbrach, nunmehr auf die westliche Industriegesellschaft insgesamt übergegangen. Anders als sie es selbst verstehen, haben George W. Busch und seine Verbündeten recht, wenn sie von einer Bedrohung der Zivilisation sprechen: Es ist die Krise der westlich dominierten wissenschaftlich-technischen Zivilisation, die von den Abfallprodukten ihrer eigenen Dynamik, Globalisierung genannt, eingeholt wird.
Es scheint, als ob die USA in dieser Situation die ganze Welt unterwerfen könnten; ihr Aufstieg zum Gipfel der einzigen Weltmacht, welche die übrige Welt unter ihre Bedingungen zwingt, ist jedoch schon die Voraussetzung ihres Abstieges: Die “Allianz gegen den Terror” ist auf begrenzten Interessen begründet. Sicher, Russland ist interessiert, unter dem Deckmantel der Allianz seinen Einfluss in Zentralasien wieder herzustellen, womöglich gar noch auszuweiten, und auch China in die Schranken zu weisen, um dessen Übergriff auf Sibirien und den fernen Osten zu verhindern. Aber die Amerikaner holen in Afghanistan nur die Kohlen aus d e m Feuer, das die Russen anschließend mit humanitärer Hilfe, mit Waffenlieferungen, mit Angeboten zum Wiederaufbau usf. zu löschen versuchen. Besser könnten die Russen die Wunden, die ihnen Afghanistan seinerzeit geschlagen hat, nicht heilen.
Ähnliches gilt für den Kaukasus und für die GUS-Länder: Eine begrenzte Präsenz der Amerikaner im Kampf gegen örtliche “Terroristen” schafft der russischen Regierung Spielraum für zivile und wirtschaftliche Aktivitäten in diesen Gebieten, wo die Russen als Kolonisatoren verhasst sind, aber dennoch gebraucht werden. Wenn die Amerikaner sich an den Tschetschenen in Georgien die Finger verbrennen, brauchen es die Russen nicht mehr zu tun. Das ist für Moskau allemal überschaubarer als die bis dahin vom Kreml beklagte klammheimliche Unterstützung kaukasischer Separatisten durch die CIA.
Langfristig dürfte das Kalkül, dass Russland und die USA sich den euroasiatischen Raum aufteilen könnten, allerdings auf Sand gebaut sein: Da ist zunächst China, da ist Indien, da ist der Iran, da sind die Interessen der zentralasiatischen GUS-Länder, die sich zwischen den Giganten einen neuen Lebensraum aufbauen wollen. Deutlich drückt sich das im Zusammenwachsen der Shanghai-Gruppe aus, dem regionalen Bündnis zwischen Russland, China und der Mehrheit der GUS-Staaten, das sich seit Mitte der 90er Jahre um den gemeinsamen Aufbau eines zentralasiatischen Wirtschaftsgebietes bemüht.
Zwar ist China wie Russland daran interessiert, unter dem Deckmantel der “Allianz gegen den Terror” separatistische Bestrebungen im eigenen Staatsgebiet niederzuschlagen. Noch wichtiger als das amerikanische Stillehalten aber ist den Chinesen die Ausweitung ihres Einflusses nach Sibirien und in den zentralasiatischen Raum. In diesem Spiel ist die Niederschlagung der islamischen Uiguren nur e i n Schachzug. Wichtiger ist der Bau von Trassen, Bahnen und Pipelines, die den zentralasiatischen Raum und den indischen Subkontinent für China öffnen. Ähnliches gilt für die lange nördliche Grenze mit Russland, über die China wirtschaftlich in den sibirischen Raum drängt. Es geht auch für China um den Zugriff auf Rohstoffe und um die Öffnung neuer Märkte für seine aufstrebende Produktion. Hier könnten die USA erhoffen, als lachender Dritter Nutzen aus einem Konflikt zwischen China und Russland zu ziehen. Tatsache ist allerdings, dass sowohl Russland als auch China in Zentralasien und Sibirien langfristig eher auf eine Abstimmung ihrer gegenseitigen Interessen als auf die Unterstützung der USA angewiesen sind.
Kommt hinzu, dass die USA kaum Interesse zeigen, in die infrastrukturelle und kulturelle Entwicklung des zentralasiatischen Raumes zu investieren. Ihr Interesse liegt in der Ausbeutung der Ressourcen und in der strategischen Besetzung des Raumes durch einen oder mehrere militärische Brückenköpfe. Nicht Entwicklung und kooperative Beziehungen, sondern Beherrschung und wirtschaftliche Ausbeutung des Raumes sind Ziel der dortigen US-Politik. Hier liegt auch der Dissens zwischen den USA und den Europäern begründet, der neuerdings wieder deutlicher hervortritt. Kurz gesagt: Europa hat ein konkretes wirtschaftliches Interesse an der durchgängigen und nachhaltigen Entwicklung des euroasiatischen Zentralraumes als Teil seiner eigenen geografischen, wirtschaftlichen und kulturellen Realität. Die USA haben dieses Interesse nicht. Sie sind an schnellen Gewinnen und leicht, bzw. verlässlich zu beziehenden Ressourcen interessiert. Nur das strategische Interesse, China und Russland in Schach zuhalten, könnte die USA und Europa verbinden. Aber selbst hier verfolgen die Europäer, durch infrastrukturelle Großraumgestaltung mit den Russen und Chinesen verbunden, andere Konzepte als die Amerikaner.
Kurz gesagt, die gegenwärtige “Allianz gegen den Terror” deckt nur vordergründige, kurzfristigste gemeinsame Ziele bei einander sonst widerstrebenden Interessen ab.
2.Sprecher :
Da ist zum Beispiel das Modell einer mono-, bzw. unipolaren Welt unter Führung der USA, kurz und klar “neues Empire” genannt. Dabei dürfte neben der Ablehnung des Konzepts einer multipolaren Welt die Stoßrichtung gegen China das stärkste Motiv sein.
Zu nennen ist auch der von russischen Nationalisten entwickelte Entwurf einer Widerherstellung der alten Machtaufteilung zwischen den USA und Russland. Dabei sollen die Amerikaner die Rolle der maritimen Kolonialmacht spielen, während die Russen sich als Führungsmacht des euroasiatischen Kontinents einschließlich Chinas präsentieren. Das liefe eindeutig auf Konfrontation hinaus.
Dann gibt es noch das Konzept einer “duopolaren” Konstellation, wo sich Russland und die USA gegen die “asiatische Gefahr”, speziell China , zusammentun. Dabei soll Russland die Versorgung der USA mit Ressourcen, und die USA die Weltsicherheit garantieren. Die gegenwärtige Politik scheint nach diesem Muster zu laufen. Diese Konzeption geht aber an den langfristigen Interessen Russlands und der gesamten südlichen Halbkugel des Globus vorbei.
1. Sprecher :
Jenseits all dieser Vorstellungen hat China in der Zeit, wo es seit der Spaltung der kommunistischen Welt von 1964 weder zum kapitalistischen, noch zum sowjetischen Lager gehörte, die Strategie einer multipolaren Weltordnung entwickelt. Mit Beginn der Perestroika übernahm Michail Gorbatschow diese Option auch für Russland. 1997 legten Russland und China der UNO ein entsprechendes Papier zur Entwicklung der Weltordnung vor. Die wichtigsten ehemaligen Kolonien in der sogenannten dritten Welt, allen voran die Entwicklungsführer des euro-asiatischen Großraumes wie Indien, Iran, Pakistan fordern heute eine solche Ordnung, deren potentielle Träger sie dann wären, natürlich ausgenommen China und Russland.
Unter Wladimir Putin hat Russland zwar viele Aspekte des von Michail Gorbatschow propagierten “Neuen Denkens” im Zuge einer autoritären Restauration relativiert – nicht aber die Ausrichtung der Außenpolitik an den Grundzügen der multipolaren Strategie. Auch wenn es bei den Auftritten Wladimir Putins im Westen heute manchmal so scheint, als ob der russische Präsident ein Deutscher oder Amerikaner werden wolle, so sollte doch niemand übersehen, dass derselbe Wladimir Putin China, Korea, auch Indien, dem Irak und dem Iran mit denselben Gesten gegenübertritt: In Europa ist Wladimir Putin Bewohner des europäischen, in China des asiatischen Hauses. Für Indien, den Iran, Irak usf. ist er der beste Nachbar des euroasiatischen Subkontinents. Das ist kein falsches Spiel von Wladimir Putin, sondern das ist die reale Rolle, die Russland in der Welt hat, heute wie damals. Eine Rolle, die sich aus seiner geostrategischen Lage zwischen Asien und Europa, zwischen Eismeer und indischem Subkontinent, zwischen Ost-Rom, mongolisch-chinesischem Großreich und westlichem Abendland entwickelt hat und in deren Folge der russische Raum – auch nach dem Ausscheiden der GUS-Staaten – immer noch von mehr als 150 Völkern bewohnt wird. In seiner offenen euro-asiatischen Zentrallage ist Russland heute so etwas wie der natürliche Motor einer multipolaren politischen Orientierung. Mehr noch als China, das zwar auch ein Vielvölkerstaat ist, der sich aber in der Abgeschiedenheit einer pazifischen Randlage des euroasiatischen Kontinentes entwickelte. Russland dagegen ist offen nach allen Himmelsrichtungen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Position Europas: Kann man Russland als Herz einer spontan gewachsenen multipolaren Ordnung Euroasiens betrachten, so die Europäische Union, die aus einer Vielzahl von Stämmen, Völkern und Nationen in einer langen Geschichte der Kriege nun als multinationale Union heranwächst, als ein Modell. Gemeinsam können Russland und die Europäische Union Impulsgeber für eine kooperative Neuordnung werden, am besten mit China zusammen und gruppiert um den neutralen Raum der Mongolei – wenn sie nicht in Wiederholung unseliger Achsenbildungen in den Versuch abgleiten, die angeschlagene Hegemonialordnung mit Gewalt gegen die anstehenden Veränderungen, in dem Falle auch gegen China, zu halten.
Die Versuchung ist groß. Denn die Krise ist nicht nur eine politische, die durch Kabinettskompromisse an grünen Tischen entschieden werden könnte, sondern auch eine soziale: Der weitgehend verdrängte Klassenkampf kehrt in Form nationaler und nationalistischer Unabhängigkeitsbestrebungen wie auch als anti-westlicher religiöser Fundamentalismus aus den ehemaligen Kolonien in die Metropolen zurück. Es fehlt nur noch der organisierende Impuls. Zur Zeit flackert die Unzufriedenheit mit einer ungerechten globalen Ordnung in hilflosem Terrorismus auf. Langfristig aber ist die Revolte gegen die sozialen Folgen einer von den Metropolen ausgehenden Globalisierung weder aufzukaufen, noch als bloßer Terrorismus zu denunzieren, und schon gar nicht mit Gewalt zu unterdrücken, wie die USA es gegenwärtig versuchen. Sie ist aber auch nicht durch verbale Bekundungen zur “Bekämpfung der Armut in der Welt” wegzureden, wie man es von europäischer Seite, vor allem von der deutschen Bundesregierung zur Zeit hört. Der Kampf gegen die Armut muss als konkrete, langfristig angelegte Entwicklungsförderung auch gegen die kurzatmigen Ziele und gegen die technizistische und von militärischen Gesichtspunkten bestimmte Politik der USA durchgesetzt werden.
Die Auseinandersetzung um diese Fragen wird auch unsere eigene Situation hier in Europa transformieren. Sie wird zur Rückkehr sozialer Konflikte in unseren Alltag führen, zu einer Polarisierung zwischen denen, die Privilegien der Festung Europa gegen den Ansturm aus den ehemaligen Kolonien verteidigen und jenen, die sich als Partner in den weltweiten Kampf gegen Armut einbringen wollen.
Die Welt, die so entsteht, ist nicht mehr die Welt, in der die Forderungen aus den Tagen der französischen Revolution nach “Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit” auf Freiheit ODER Gleichheit verkürzt werden konnten. Wo Freiheit der einen zur Freiheit der Ausbeutung von anderen und Gleichheit bei den anderen zu Gleichmacherei verkam. Gleichheit und Freiheit werden in Zukunft durch das Prinzip einer Kooperation verbunden werden, die aus der Einsicht kommt, dass Überleben und Entwicklung heute nur noch in gegenseitiger Unterstützung möglich sind. Der Förderung dieses Impulses muss daher alles Bemühen gelten. Das ist die Moral einer anderen Globalisierung.
Regie: Musik
Die Entwicklung dieser Moral hat heute oberste Priorität: Es ist, als hielte die Welt den Atem an. Wir befinden uns in einem Energieknoten, Wendepunkt: im Auge des Taifuns. Wir müssen den Ort neu bestimmen, an dem wir uns befinden. Die Dimensionen menschlicher Entwicklung werden neu ausgelotet: Zuende geht der Streit, ob Krieg oder Kooperation der Ursprung aller Dinge sei. Nach einer langen Geschichte der Kriege, insbesondere nach den letzten beiden Weltkriegen, wissen wir, dass die Wahrheit nicht in dem einen oder dem anderen Pol liegt, sondern in der Vermeidung von Einseitigkeiten, im Dialog, in der Beziehung. Das ist die Botschaft der französischen Revolution, die bisher n i c h t verwirklicht wurde: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Keines dieser Elemente ist ohne die anderen möglich: Freiheit ohne Gleichheit führt ins Asoziale, Gleichheit ohne Freiheit in den Terror; in beiden Fällen fehlt als verbindendes Element die Brüderlichkeit. Das ist: Gegenseitige Hilfe, Kooperation. Aber selbst Kooperation ist ohne Gleichheit nicht möglich und ohne Freiheit verkommt Brüderlichkeit zu Bruderschaften, Nationalismus und Terror.
Die Welt des zurückliegenden Jahrhunderts hatte sich in der Polarität von Gleichheit hier und Freiheit dort als zwei polaren gesellschaftlichen Modellen verfestigt. Die sowjetische Perestroika hat die Auflösung dieser Polarisierung von der Seite der Gleichheit her eingeleitet; der Krieg gegen den Terrorismus leitet, durch seinen Anspruch, Freiheit mit Gewalt durchsetzen zu wollen, die Auflösung des Freiheitsmodells ein. Was die zukunftsweisende Botschaft der “Neuen Welt” war, Demokratie und Menschenrechte, wird zu deren ideologischer Absicherung.
Zwei gegenläufige Bewegungen gehen daraus hervor: Globalisierung hier und Anarchisierung dort. Es geht um die Suche nach neuen Identitäten. Neue Identitäten sind aber nicht allein auf der Suche nach Freiheit oder Gleichheit zu finden, sondern nur in Verbindung mit dem bisher vernachlässigten Prinzip der gegenseitigen Hilfe, weil ein Überleben, ganz zu schweigen von einem erfüllten und menschenwürdigen Leben auf diesem enger gewordenen Planeten in Zukunft nur kooperativ möglich ist.
Diese Kooperation betrifft all drei Sphären: die menschlich-gesellschaftliche, die global- ökologische und die universale des Kosmos. In der gesellschaftlichen Sphäre beinhaltet sie ein multipolares Weltbild statt eines monopolaren. Völker, Regionen, Religionen sind darin wirtschaftliche und kulturelle, aber keine imperialen, nationalen Einheiten. Die Verwandlung der aus dem Zerfall der bipolaren Welt entsprungenen nationalen Ansprüche in solche wirtschaftlichen und kulturellen Einheiten einer multipolaren Ordnung erleben wir heute. Sie geht nur langsam vor sich und nicht ohne Konflikte. In der globalen, ökologischen Sphäre geht es um eine neue Beziehung unserer Industriegesellschaft zur belebten und unbelebten Natur. Unser Globus wird nur überleben, wenn wir ihn als lebendiges Ganzes wahrnehmen, dessen Teile in organischer Wechsel-Beziehung zueinander stehen. Wir müssen realisieren, dass wir nicht nur Kopf, sondern auch Leib dieses Planeten sind – und umgekehrt, daß Tiere, Pflanzen und die Substanz der Erde nicht nur Materie sind, sondern hochgeordnete, im homöopathischen Sinne hochgradig potenzierte Materie und darüber hinaus lebendiges, beseeltes Leben, das nur mit unserer Hilfe eine Zukunft hat. In der kosmisch-universalen Sphäre geht es um die Erkenntnis der Besonderheit unseres Planeten in einem grenzenlosen Universum, genauer, um die Frage, welche Kräfte unser lebendiger Planet aus dem unendlichen Kosmos zieht – und welche er abgibt. Es ist die Frage nach der Einzigartigkeit unserer Spezies, nach dem Sinn ihrer Existenz, nach Geburt und Tod, nach einer für den ganzen Planeten verbindenden Ethik.
Regie: Musik
Dies alles bedeutet: Der Maßstab für Fortschritt liegt in Zukunft nicht mehr allein im wissenschaftlich-technischen, sondern im ethischen Bereich; Freiheit muss sich nicht mehr in der Aufblähung eines individualistischen Superego, Gleichheit nicht in einem über jeder Individualität stehenden Kollektivwohl beweisen, sondern darin, sich selbst und anderen ein Leben in Freiheit und Gleichheit zu ermöglichen. Von selbst wird diese Verwandlung sich nicht vollziehen. Der Mensch ist ja nicht nur Objekt, sondern auch bewusst handelndes Subjekt der Geschichte. Sich selbst überlassen, wird die anstehende Verwandlung mit dem Zerfall der alten Welt enden, ohne daß die neue entsteht.
Die alte Welt, das ist die Hegemonie des technisch-wissenschaftlichen Zivilisationstyps westlicher Prägung in seiner “kapitalistischen” wie auch in seiner “sozialistischen” Variante. Wie ihre Zerfallsprodukte aussehen könnten, das lassen die gegenwärtigen terroristischen Anschläge und Anti-Terror-Einsätze ahnen, die in einen Krieg aller gegen alle zu schliddern drohen, der, wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, nur mit einer Zerstörung des Lebens auf unserem Planeten enden kann.
Das Wissen um diesen drohenden Gang der Dinge ist die Basis für die Einsicht in die Notwendigkeit der gegenseitigen Hilfe. Da Angst aber erfahrungsgemäß kein ausreichendes Motiv für eine Änderung eingefahrener Weltbilder ist, eher deren Verhärtung provoziert, stellt sich die Frage, woher die Kräfte kommen, die eine Orientierung auf den schöpferischen Teil der Verwandlung unserer altgewordenen Weltbilder möglich machen. Die Antwort drängt sich auf: In Russland und mit Varianten auch in China ist es die Dynamik der Individualisierung, die aus einer ins Extrem getriebenen Tradition des Kollektivismus herausschießt. Im Westen ist es umgekehrt die Sehnsucht nach sinnstiftender Gemeinschaft, die aus der Inflation des Individualismus hervorgeht. Beides treibt die Suche nach neuen Wegen des Lebens an. Wie steht es mit der übrigen Welt? Asien? Afrika? Südamerika? Australien? Neuseeland? Diese Länder, Völker und Kulturen wirken bereits durch ihre bloße Existenz als Impulsgeber. Der durch sie gegebene faktische Pluralismus bildet die materielle Grundlage zukünftiger Entwicklung. Nicht Huntingtons Krieg der Kulturen, sondern das demokratische Miteinander der Völker, der Kulturen und Religionen wird die Welt von morgen ermöglichen.

Themenheft 12: Modell Kasan?
THEMENHEFT 12:
Modell Kasan?
Islam, Völkervielfalt, Föderalismus
Koexistenz statt Terror
Modell Kasan: Islam in Russland –
Front im Krieg der Kulturen oder Ansatz für eine Alternative?
Dritte Hauptstadt – Kasan
Im Kreml von Kasan:
Gespräche mit Dr. Raffael. Chakimow,
politischer Ratgeber des Präsidenten von Tatarstan
Teil 1: Moskau und seine Khane
Teil II: Über das Leben mit einem modernisierten Islam
Im geistlichen Zentrum des Islam:
Valjulla M. Yaghupow, Assistent des obersten Mufti von Kasan
Über die Chancen der Koexistenz
zwischen Islam und Christentum
Der wissenschaftliche Blick:
Gespräch mit Rafik Muhammedschin, Islam-Spezialist
Ü ber Geschichte und Aktualität des Jadidismus,
der tatarischen Form des Islam
Fan Walischin, der erste tatarische Philosoph
Russland an der Wolga: Ein Tag in Nabereschny Tschelni
Zur Person des Autors

THEMENHEFT 11: China ante Portas?
THEMENHEFT 11:
China ante Portas?
Stationen einer Reise ans Ende der europäischen Welt
im Sommer 2002
Von Moskau nach Tscheboksary
Dritte Hauptstadt – Kasan
Ulaanbaator – Beobachtungen am Rande der zivilisierten Welt
Ausflug nach China
Einwanderungsland Sibirien? Beispiel Irkutsk Blagoweschinsk – Brücke über den Amur?
Wladiwostok – Vorposten Europas?
Nachträge:
Kongress der Mongolisten in Ulaanbaator
– ein Beitrag zur De-Eskalation in Zentralasien
Mongolia and the outside world –
a chance for mutual transformation
Beobachtungen zur „chinesischen Frage“
Zur Person
Stille Invasion an Chinas Grenzen? Beobachtungen zur „chinesischen Frage“. Korrektur nach einer Reise entlang der russ. chin. Grenzen
Skeptisch geworden gegenüber den Zahlenangaben zur angeblichen Invasion Chinas in den Eurasischen Raum, die ich selbst in einem Feature 2002 noch weitergegeben hatte, machte ich mich im Sommer 2002 in einer dreimonatigen Untersuchungsreise auf den Weg zur Überprüfung vor Ort. Ergebnis: Die Höhe der angebliche 6 Millionen chinesischer Einwanderer ist eindeutig eine politische Zahl.Vergleiche dazu
* kritisch das Feature: China - Russland: Stille Invasion oder startegische Partnerschaft
* aufgearbeitet: mein Buch: "Asiens Sprung in die Gegenwart
Wladiwostok – Vorposten Europas in Asien?
Sieben Zugnächte von Moskau entfernt endet im Osten an der Küste des Atlantic die Fahrt der transsibirischen Eisenbahn in Wladiwostok, dem äußersten Ausleger Russlands im Osten. Umgeben vom Bogen der japanischen Inseln im Westen, der Halbinsel Koreas und dem großen chinesischen Hinterland im Süd-Westen liegt die Stadt als Wachtposten Russlands auf den Hügeln vor dem japanischen Meer. Der Festungscharakter der Stadt ist auch heute nicht übersehbar: Kriegsschiffe, wenn auch manche nicht in bestem Zustande, bestimmen das Bild des Hafens.
Aber nicht russische Kolonisten gründeten die Stadt, sondern französische Händler. Ein Stadtbild europäischen Zuschnitts: Nicht russische Architektur – Holzhäuser, Kuppeln uä., sondern mitteleuropäische prägt das Zentrum; der Hafen erinnert eher an Madrid, Bordeaux oder Hamburg Von Wladiwostok aus ist St. Francisco schneller zu erreichen als Paris, Berlin oder Madrid. Der Westen liegt im Osten, der Osten im Westen. Erst im weiteren Umkreis zieht sich die typische Plattenbebauung der neueren sowjetischen Zeit die umgebenden Hügel hinauf.
Hier in Wladiwostok fühlt man sich ganz europäisch. „Wladi Wostok“, wörtlich „Beherrsche den Osten“ – das war das Programm der Gründer dieser Stadt. Als „Vorposten Europas in Asien“ fühlten sich Wladiwostoks Einwohner/innen zur Sowjetzeit und, das versichern sie schmunzelnd, so verstehen sie sich auch heute. Vorposten war Wladiwostok im doppelten Sinne: Vorposten der europäischen Kolonisation in Asien Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, später Vorposten Russlands, danach der UdSSR und als bedeutendster sowjetischer Kriegshafen bis 1992 geschlossenes Gebiet. Hier erinnert man sich an drei japanisch-russische Kriege, hier ist die Konfrontation des Kalten Krieges noch frisch im Gedächtnis. Erst Perestroika öffnete die Stadt wieder für den Westen. Dem einheimischen Maler Igor Rubaschuk war diese Tatsache wichtig genug, um sie in einem Bild: „Besuch des französischen Kriegsschiffes Jean D`Ark im Hafen von Wladiwostok,“ festzuhalten, das heute in Galerien und Broschüren der Stadt gezeigt wird.
In seiner Doppelrolle als Vorposten Russlands und des Nicht-russischen Westens zugleich hat Wladiwostok immer eine Sonderrolle gespielt. Nicht von ungefähr wurde mit dem Bau der transsibirischen Eisenbahn von hier aus begonnen. Obwohl geschlossene Stadt, beanspruchte Wladiwostok als einziger ozeanischer Hafen der UdSSR auch zur Sowjetzeit eine besondere Rolle. Auch Perestroika nahm in Wladiwostok ihren besonderen Verlauf. Unter seinem Gebiets-Gouverneur Nostratenko galt Wladiwostok als besonders eigenwillig; zur Zeit Boris Jelzins kursierten Gerüchte über Abtrennungstendenzen des „Primorsker Gebietes“.
Von Wladiwostok aus wurde auch die „chinesische Frage“ am schärfsten gestellt. Gouverneur Nostratenko gefiel sich in scharfen chauvinistischen Warnungen vor der „gelben Gefahr“, vor der „chinesischen Expansion“ und „millionenfachen Invasion“, nicht zuletzt, um so von Moskau besondere Zuwendungen und Vollmachten zu ertrotzen. Bis heute geistern die Zahlen aus dieser Zeit durch die westlichen, einschließlich Moskauer wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Medien. Sie differieren von 1,5 bis 6 Millionen Chinesen, die bereits in Russland lebten.
Von Wladiwostok aus wird die „chinesische Frage“ nach ihren chauvinistischen Überreizungen durch Nostratenko jetzt allerdings auch am ernsthaftesten analysiert; der „Hysterismus“ der zurückliegenden Jahre wird relativiert und aktiv bekämpft: Die chinesische Migration, so kann man jetzt von führenden Spezialisten des Ortes, zum Beispiel dem Direktor des „Instituts für Geschichte , Archeologie und Ethnologie der Völker des fernen Ostens“, Prof. Larin, hören, sei keine Frage der Quantität, sondern der Qualität. Erstens sei die Zahl der chinesischen Migranten in der jüngsten Vergangenheit heillos übetrieben worden; tatsächlich hielten sich im gesamten fernen Osten und in Sibirien, einschließlich illegaler Einwanderer zur Zeit zwischen 200.000 und 300.000 Chinesen auf, keines Falles aber mehr als 500.000. Die Zahl der effektiv in Russland siedelnden Chinesen wird von Prof. Larin und Kollegen in anderen russisch-chinesischen Grenzstädten im Bereich von ein, zweitausend angesiedelt.
Entscheidend, so Professor Larin, sei ohnehin nicht die Frage der Zahl der chinesischen Immigranten, sondern die Frage, wie mit ihnen, wie generell mit der Tatsache der Immigration von Seiten der russischen Behörden umgegangen werde. Im Grunde biete das aktuelle Wachstum der chinesischen Wirtschaft und die chinesische Migration nach Russland die Chance einer gemeinsamen wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des fernöstlich-sibirischen und zentralasiatischen Raumes – wenn sie von den russischen Behörden für wirtschaftlichen Austausch genutzt und nicht zu nationalistischen Zwecken mißbraucht werde.
Mit dieser Sicht der Entwicklung löst sich Wladiwostok vom „Alarmismus“ der Nostratenko-Zeit. Heute ist die Stadt bestrebt, sich zur vierten Hauptstadt Russlands – neben Moskau, St. Petersburg und Kasan – zu mausern; sie wirbt mit ihrer Weltoffenheit. Sie ist auf dem besten Wege, von einem militärischen Vorposten der Sowjetunion zum Sprungbrett des neuen Russlands nach Asien zu werden – vor allen nach China, aber auch Korea und Japan. Zugleich öffnet sie ein zweites Tor nach Westen. In der Verbindung von beidem liegt Wladiwostoks besondere Chance. Ob es eine Chance für Europa, für Russland oder für eines der asiatischen Länder ist, ist dabei schon nicht mehr wichtig, denn in Wladiwostok verlieren die Ost-West-Koordinaten ihre Bedeutung.
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550
Blagoweschinsk – Brücke über den Amur?
Eine unendliche Geschichte.
In Blagoweschinsk kommen sich Russland und China am nächsten. Diesseits des Amur liegt Blageweschinsk als behäbige Provinzhauptstadt des rusischen Amur-Verwaltungsgebietes; vom gegenüberliegenden Ufer grüsst nachts durch riesige Lichterketten hell erleuchtet, die dynamische Silhouette von ChejChej auf die Uferpromenade von Blagoweschinsk herüber.
CheiChei wurde von der chinesischen Regierung als freie ökonomische Zone deklariert, Blagoweschinsk wartet seit Jahren auf eine entsprechende Moskauer Entscheidung. Die Beziehung zwischen beiden Städten ist schnell erklärt: Blagoweschinsk lebt heute vom Handel mit chinesischen Waren. CheiChei, so erinnern sich die Blagoweschinsker, war noch vor fünfzehn Jahren ein armseliges, gottverlassenes Dorf im vernachlässigten Grenzbereich zwischen Russland und China.
Heute kann Blagoweschinsk ohne den chinesischen Markt, der über CheiChei versorgt wird, nicht mehr existieren. Als der Visazwang für einreisende Chinesen nach vorübergehender Aufhebung 1992 Mitte der Neunziger wieder eingeführt wurde, sank das Warenangebot in Blagoweschinsk vorübergehend auf das Niveau der Krisenjahre der beginnenden Perestroika. Die Bevölkerung von Blagoweschinsk, vornehmlich die weniger verdienenden Schichten, wie auch der übrigen Grenzanrainer im sibirischen Westen sowie im fernen Osten war vorübergehend wieder unterversorgt, weil nur noch Westware auf den Markt kam.
Heute können sich in Blagoweschinsk wieder alle sozialen Schichten der Bevölkerung kaufen, was sie zum Leben brauchen. Es existieren mehrere Märkte nebeneinander, die unterschiedliche soziale Schichten bedienen.
Auf dem chinesischen Markt kauft die wenig oder gering verdienende Bevölkerung der Stadt, vornehmlich aber der ländlichen Gebiete: ein russischer Markt versorgt die zahlenmässig geringe, vor allem städtische Mittelklasse des Gebietes.
Auf dem „Russischen Markt“ werden jedoch nicht vornehmlich russische Produkte, wie man denken könnte, sondern ebenfalls chinesische Waren verkauft – Ware von gehobener Qualität, die länger als die Billigware des chinesischen Marktes hält. Die Chinesen, so die Einheimischen, haben innerhalb kürzester Zeit gelernt, unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Waren zu beliefern.
Bleibt schliesslich noch der „Jahrmarkt“ zu erwähnen, der die gehobenen Ansprüche der gut situierten Bürokratie und der neuen Reichen bedient, die es selbstverständlich auch am Amur gibt.
CheiChei ist heute eine Stadt von etwa zwei Millionen Einwohnern; viele chinesische Studentinnen und Studenten besuchen die Hochschulen von Blagoweschinsk. Zehn Prozent der Bevölkerung von Blagoweschinsk sind Chinesen. „Unsere Stadt verdankt den Chinesen ihren heutigen bescheidenen Wohlstand“, so ist von russischen Kleinunternehmern und in intellektuellen Kreisen der Stadt zu hören. Andere Töne hört man aus den Kreisen der einheimischen Leichtindustrie. Sie fühlt sich durch die chinesische Konkurrenz bedroht. Sie würden die Chinesen, um den bekannten russischen Volksdemagogen Wladimir Schirowski zu zitieren, am liebsten in den Amur jagen. Auf’s Ganze gesehen aber lebt man gut mit den Chinesen. Von „Gelber Gefahr“ ist hier in Blagoweschinsk nicht die Rede; hier ist die Rede von den Vorteilen gutnachbarschaftlicher Beziehungen.
Drei Vorteile werden vor allen anderen genannt: die Versorgung des Marktes mit Waren, die Aufffüllung des unterversorgten Arbeitsmarktes mit Arbeitskräften, die rege Bautätigkeit chinesischer Eigentümer auf russischem Boden. Dies alles, so das weitgehend übereinstimmende Resumee, gilt als positiv. Als negativ gilt allein die illegale Zuwanderung; die jedoch hält sich nicht nur nach offiziellen Angaben, sondern auch aus Sicht von deren Kritikern, inzwischen in kontrollierten Grenzen.
Da wundert man sich schliesslich, warum das Projekt einer Brücke über den Amur, das bereits seit 1992 zwischen den Vertretern der Städte Blagoweschinsk und CheiChei diskutiert wird, nicht schon lange begonnen wurde. Beide Seiten sind angeblich interessiert, Peking wie auch Moskau haben ihr strategisches Einverständnis erklärt. Der Bau der Brücke wäre ein grosser Schritt zur Entwicklung aktiver wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Russland und China im Amur-Raum und im fernen Osten, zumal noch eine weitere Brücke bei Chararowsk weiter im Osten im Gespräch ist.
Alle Seiten versichern ihr Interesse an einer solchen Brücke. China hält Finanzen und Arbeitskräfte bereit, allerdings mehr Arbeitskräfte als Finanzen. Der russische Präsident ist mehrmals in seiner Amtszeit im fernen Osten gewesen, sein Wirtschaftsminister in den letzten zwei Jahren mehr als ein dutzend mal. Dennoch ist noch kein erster Spatenstich erfolgt. Die Gründe sind schwer zu ermitteln. Die örtliche Bürokratie hüllt sich in Schweigen. Aus Hinterzimmern ist jedoch vernehmbar, Moskau verzögere die Entscheidung.
Örtliche Geschäftsleute, die an der Brücke interessiert sind, noch mehr örtliche Intellektuelle, die sich kritisch mit der Frage der chinesischen Immigration befassen, machen die Unfähigkeit der örtlichen Bürokratie verantwortlich, die keine klare Politik in der Frage der Beziehungen zu China habe.
Die Wahrheit dürfte wohl darin zu finden sein, dass Moskau zwar klare strategische Interessen an einer starken Kooperation mit China hat, allein schon, um den USA etwas entgegenzusetzen, das aber innerrussische Clans und regionale Interessengruppen bei einer solchen Öffnung der Grenzen um ihre Monopolstellung fürchten, die sie jetzt trotz allem immer noch geniessen. Gewiss aber ist: Solche und ähnliche Gründe können den Bau der Brücken verzögern, verhindern können sie ihn nicht.
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550
Ausflug nach China
Ulaanbaator,
Samstag, 24. August 2002
Von Ulaanbator ist es nur noch eine Tagestour, 600 km, mit der Bahn nach China. Ein Visum ist leicht besorgt: Zwei Stunden Schlange-Stehen vor der chinesischen Botschaft, dreißig Dollar – das ist alles, was an Hürden zu überwinden ist. So leicht ist das also?
Nein, so leicht ist es nicht. Nach dem leichten Auftakt folgt eine Hürde der nächsten: Es beginnt mit den Fahrkarten. Platzkarten für ein Coupé sind nicht zu bekommen. Es gibt nur noch Karten für die „offenen Waggons“. Selbst die erweisen sich als hoffnungslos überfüllt; die Fenster sind trotz glühender Hitze nicht zu öffnen. Auf sechs Plätze kommen acht Menschen. Schon vor der Abfahrt ist die wenige Kleidung, die man trotz der Hitze anstandshalber noch tragen muß, bereits durchgeschwitzt. Männer sitzen mit nacktem Oberkörper, Frauen fächeln sich Luft unter die Blusen.
Als der Zug sich endlich in Bewegung setzt, wird an der weiter steigenden Hitze und den Staubwolken, die den Zug begleiten, klar: Der Weg führt von Ulaanbaator geradewegs durch die GOBI. Selbst nachts ist vor Hitze an Schlaf nicht zu denken.
Morgens früh um sechs erreicht der Zug den mongolischen Grenzort Saming Ud, was soviel heißt wie Grenztor oder Zolltor. Der Ort liegt mitten in der Wüste Gobi und ist das Tor der Mongolei nach China.
Saming Ud – das ist das Bahnhofsgebäude, darum herum ein paar eingezäunte Höfe mit Jurten. In Saming Ud endet die Fahrt des mongolischen Zuges. Jenseits der Grenze, schon auf chinesischem Staatsgebiet, liegt Ereen. Zwischen Saming Ud und Ereen müssen alle Passagiere umsteigen, um per Bahn, Bus oder in Jeeps die Grenze zu überqueren. Hektik entsteht. Jeder will der Erste sein. Auf der chinesischen Seite der Grenze staut sich die Kolonne mongolischer Jeeps, Busse; dann kommt auch noch der Zug. Alle stehen in glühender Hitze auf freier Steppe.
Mittags machen die chinesischen Grenzer zwei Stunden Pause. Nur chinesische Wagen werden durchgewunken. Antichinesische Ressentiments werden laut. Man schimpft über die schikanösen Kontrollen, über den Hochmut, über die Menschenfeindlichkeit der Chinesen, bei der der einzelne Mensch nicht zähle, über den „Gestank“, der aus der GOBI in die Mongolei hineinwehe. Überhaupt sei der „chinesische Geruch“ für Mongolen nicht aushaltbar. Man schwärmt von der schönen, freien Mongolei. Mentalitäten treffen hier aufeinander. Es ist offensichtlich, daß die Reisenden nur widerwillig die Grenze passieren. Warum tun sie es also? Warum nehmen so viele Menschen diese Fahrt durch die Gobi, die Hektik dieser Kontrollen auf sich? Und das, wie ich höre, jeden Tag?
Es geht um den Grenzhandel, erklären meine Begleiter. In Ereen kann man billig einkaufen. Die Hektik erkläre sich aus der Tatsache, daß diejenigen die besten Chancen hätten, die zuerst in Ereen ankämen.
Am späten Nachmittag, als wir selbst endlich Ereen erreichen, wird die ganze Szene mit einem Schlage klar: Die Stadt ist ein einziger Marktplatz. Anfang der 90er Jahre lebten in Ereen 6 – 7000 Menschen unter ärmlichsten Verhältnissen; heute leben dort über 80.000, Tendenz steigend. Buchstäblich an jeder Ecke wird gebaut. Ereen lebt und wächst vom Grenzhandel mit der Mongolei.
Altes China – Fahrradrikschas und jämmerliche Armut barfüßiger und halbnackt herumlaufender Menschen, die in elenden, nicht kanalisierten stinkenden Hütten hausen – und modernste Architektur nach westlichem Muster prallen hier brutal aufeinander. Das Alte wird gnadenlos abgerissen, die Entstehung des Neuen kann man von Tag zu Tag beobachten. Meine mongolischen Begleiter sind fasziniert und abgestoßen zugleich von der Geschwindigkeit dieses Wachstums. „Sie verstehen zu bauen, die Chinesen“, sagen sie, „aber wenn wir sie ins Land holen, werden sie uns verschlucken.“
In Ereen, das begreift man innerhalb von wenigen Minuten, hört die westliche Welt auf. Keine russische, keine mongolische Verlängerung dieser Welt reicht bis in diesen Ort. Hier gelten nur noch zwei Werte: Der eine ist der gnadenlose Handel mit Billigware jeglicher Art, die hier aus allen Teilen Chinas angeliefert und von mongolischen Kleinhändlern im täglichen Grenzverkehr in die Mongolei und von dort nach Russland geschafft wird. Als Zwischenhändler und Vermittler nomadisieren die mongolischen Händler zwischen einem von Waren strotzenden China auf der einen und einem darbenden Russland auf der anderen Seite ihrer Staatsgrenze.
Das zweite, was in Ereen zählt, ist China: In Ereen wird nicht mehr Russisch gesprochen, auch nicht englisch, französich oder sonst eine westliche Sprache. Internationale Begriffe sind hier nicht bekannt. In Ereen wird Chinesisch gesprochen. Zahlen werden nicht an den Fingern abgezählt, sondern in Gesten dargestellt. Selbst Mongolisch ist kaum noch zu hören, obwohl Ereen auf den Handel mit den Mongolen angewiesen ist und zudem zur „Autonomen Republik der Inneren Mongolei“ gehört, die verfassungsgemäß über eine eigene Sprachhoheit verfügt.
In Ereen wird zudem weder russisch, noch mongolisch oder sonst irgendwie westlich gekocht und gegessen, in Ereen gibt es ausschließlich chinesische Küche. Unübersehbar ist in diesem Zusammenhang auch der Ursprung mongolischer Ressentiments: Wer jemals chinesischen Reisschnaps getrunken hat, gewinnt vielleicht eine Vorstellung von den Gerüchen, die von dieser Stadt ausgehen.
In Ereen kann es einem passieren, daß jemand lächelnd auf einen zukommt, prüfend den nackten Arm oder das Gesicht betastet, um sich ein Bild von der Andersartigkeit dieses wunderlichen Ausländers zu machen.
Kurz gesagt: In Ereen endet nicht nur sprachlich die westliche, die russische und schließlich die russisch-mongolische Welt, hier endet auch der Geltungsbereich westlicher Mentalität und Psychologie. Gleichzeitig entsteht hier eine Art von aggressivem industriellem Modernismus, die über den im Westen bekannte weit hinausgeht. In Ereen, so scheint es, entsteht die Welt neu.
Was in der Grenzstadt Ereen als Ausnahme erscheint, zeigt sich in der Provinzhauptstadt der Inneren Mongolei, ChuChot als Regel: Auch diese Stadt boomt; gnadenlos wird die Altstadt niedergerissen und durch moderne Wohnblocks ersetzt, um Raum für die wachsende Bevölkerung zu schaffen, deren Zahl die 2,5 Millionen bald überschreitet.
Aber es ist nicht die mongolische Bevölkerung, die wächst, es sind vor allem aus dem Inneren Chinas hinzuziehende Chinesen. Nur noch 20% der Bevölkerung der ehemals mongolischen Stadt ChuChot sind Mongolen der Inneren Mongolei. Auch für ChuChot gilt: Chinas moderne Welt ist nicht westlich, auch nicht multikulturell, sie ist chinesisch. Wie lange die in China lebenden Minoritäten sich diesem Prozess beugen, ist eine offene Frage. Sie wird zur Zeit aber nur hinter verschlossenen Türen diskutiert. Zu groß ist, bei aller wirtschaftlichen Freiheit, die man für sich in Anspruch nimmt, die Angst vor möglichen Repressionen.
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550
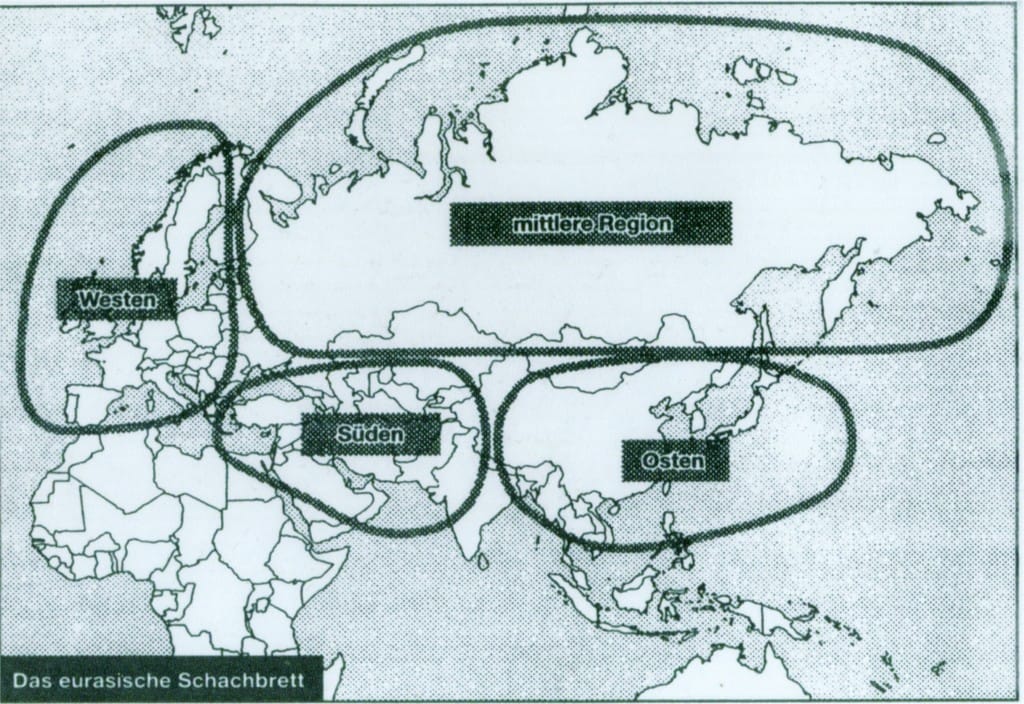
Themenheft 10: Der amerikanische Krieg
THEMENHEFT 10:
Der amerikanische Krieg
Texte zur Modernisierungskrise des Westens
und zur multipolaren Ordnung
23. September 2001
Aus gegebenem Anlass: Alternativen entwickeln S. 1
16. September 2001
Amerikanischer Krieg oder multipolare Weltordnung? S.3
25. September 2001
Putins humanitäre Hilfe S. 7
12. Oktober 2001
Warum Bomben in Zentralasien? S. 9
19. Oktober 2001
Globalisierung des Terrors –
Rückkehr der Klassenkämpfe in die Metropolen? S. 12
22. Oktober 2001
Perestroika in Amerika?
Modernisierungskrise nun auch in den USA S. 15
Hintergrund:
Januar 2001
China – Russland: Stille Invasion oder strategische Partnerschaft? S.18
April 2001
Russlands multizentrale Strategie S. 22
12. Juni 2001
Wladimir Putins dümpeln
auf den Wellen der multizentralen Strategie S. 27
7. November 2000
In Russland ist das Außerordentliche normal –
oder warum Russland trotz Dauerkrise noch nicht verhungert.
Gespräch mit dem Moskauer Ökonomen Teodor Shanin
über informelle Ökonomie S. 29
Zur Person: Über den Autor S. 38
Impulse von Tschingis Chan?
Ein Gespräch mit Prof. Bira in Ulaanbaatar über die Bedeutung des asiatischen Universalismus für die Globalisierung.
Das Gespräch führte Kai Ehlers
Prof. Bira ist leitender Sekretär der „Internationalen Assoziation für mongolische Studien“ (IAMS) in Ulaanbaatar (Ulanbator). Die IAMS zentralisiert historische und aktuelle Studien zur Geschichte, zur Lage und zur Rolle der Mongolei in der Welt, die Institution arbeitet eng zusammen mit dem „Institut für Zivilisation und Nomadentum“ (ICN), das seit 1999 mit Unterstützung der UN ebenfalls in Ulaanbaatar tätig ist. Seit 1962 treffen sich Mongolisten, Altaiisten und Nomadismusforscher der ganzen Welt alle fünf Jahre zu einem internationalen Kongress in Ulaanbaatar unter Leitung der IAMS. Zum letzten Kongress, der im Sommer 2002 stattfand, legte Prof. Bira einen Beitrag unter dem Titel „Die Mongolische Theorie des Tengerismus“ vor, in dem er darauf aufmerksam machte, dass die mongolische Expansion im 13. und 14. Jahrhundert unter den kosmologischen Vorstellungen von der Welt als Einheit stattfand. Daraus seien interessante Lehren für die heutige Globalisierung zu ziehen. Kai Ehlers, Teilnehmer der beiden letzten internationalen Kongresse der Mongolisten in Ulaanbaatar (1997 und 2002), nahm die Thesen Prof. Biras zum Anlass, ihn nach der Rolle der Mongolei und der Bedeutung Chinas im Prozess der heutigen Globalisierung zu befragen.
KAI EHLERS: Prof. Bira, in Ihrem Artikel, beschreiben sie den mongolischen Tengerismus als eine universalistische Weltsicht, die auch Bedeutung für die heutige Globalisierung haben könnte. Ich habe im Zusammenhang mit dem Problem der Globalisierung viel über chinesischen Universalismus als Impuls einer möglichen Zukunft nachgedacht. Es will mir so scheinen, als sei die Idee in Beidem fast die gleiche.
PROF. BIRA: Nun, Tengerismus – ich gebrauche diesen Begriff zum ersten Mal in der Wissenschaft. Bekannt ist, dass die Mongolen im Zusammenhang mit dem Schamanismus Tengri als die Verkörperung der großen kosmischen Einheit verehrten; der Kult Tengris war die hauptsächliche Konzeption des Schamanismus, die älteste Volksreligion der mongolischen und der turkischen Völker.
In der Tat ist Tengerismus auch so etwas Ähnliches wie Universalismus. Die chinesische Lehre des Tien min, des einen Himmels ist dem mongolischen sehr ähnlich, deshalb meinen einige Wissenschaftler, dass die Mongolen und auch die Turkvölker die Lehre von Tengri oder die des Himmels von der alten chinesischen Philosophie und politischen Lehre übernommen hätten.
Einen gewissen Einfluss von chinesischer Seite auf den mongolischen Tengerismus hat es sicher gegeben, vor allem zur Zeit der mongolischen Khane in China. Sie imitierten die Lehren von Tien Min. Von dort her mögen die Mongolen eine weitere Stärkung ihrer Lehren von Tengri bekommen haben.
Wir sollten aber nicht vergessen, dass der Schamanismus unter den nomadischen Völkern schon vor der Berührung mit dem chinesischen Universalismus existierte; und eines der wichtigsten Elemente des Schamanismus ist eben die Verehrung von Tengri als der alles umfassenden Einheit. Darüber hinaus gibt noch einen großen Unterschied zwischen dem mongolischen Tengerismus und dem chinesischen Universalismus, den wir auch nicht vergessen sollten: Der chinesische Universalismus ging niemals über die nationalen Grenzen Chinas hinaus. Die Chinesen versuchten niemals, ihren Universalismus irgendwo einzuführen (Prof. Bira benutzt das englische Verb „to implement“), seine weltweite Verbreitung zu praktizieren. Es waren die Mongolen, die als Erste versuchten, diese Lehre in die Praxis umzusetzen. Wenn Sie die weltweite Expansion des mongolischen Reiches im 14.Jahrhundert und danach betrachten, dann werden Sie sehen, dass es die mongolischen Khane waren, die versuchten diese Lehre in die Praxis umzusetzen. Deshalb ziehe ich es vor zu sagen, dass die Mongolen nicht nur die ersten Theoretiker, sondern vor allem die ersten Praktiker des Universalismus oder Tengerismus waren und deshalb entschied ich mich, ein Papier zu diesem Thema für diesen Kongress zu schreiben, weil ich die Aufmerksamkeit unserer Wissenschaftler auf dieses sehr wichtige Thema lenken möchte.
KAI EHLERS: Ja, bisher war es wohl so, dass die Chinesen sich nie über die hohen Gebirgsketten, die ihr Land umgrenzen, ausgebreitet haben; ihr Universalismus war immer ein chinesischer …
PROF. BIRA: Ja, genau, ganz und gar, der chinesische Himmel…
KAI EHLERS: …und wer sich in China aufhält, wird auch heute stark damit konfrontiert: Die Chinesen leben in China! China, China, China! Und sie beziehen die Welt auf China. Doch gibt es ein starkes ABER zu diesem bisher gültigen Bild: Die heutige wirtschaftliche Entwicklung Chinas, das geradezu in die Welt hinein explodiert! Halten Sie es für möglich, dass sich der chinesische Universalismus aus diesem Druck heraus erstmals über die ganze Welt verbreitet?
PROF. BIRA: Ich stimme ihnen zu, dass es zum ersten Mal so aussieht; es gibt Anzeichen für eine solche Entwicklung, aber ich glaube noch nicht, dass chinesischer Einfluss sich wirtschaftlich über die ganze Welt ausbreitet. Es ist zu früh, das zu sagen. Klar ist dagegen nach wie vor, dass die Chinesen, obwohl sie die älteste Tradition, die älteste Zivilisation haben, im Gegensatz zu anderen großen Zivilisationen, die inzwischen untergegangen sind, keinerlei historische Erfahrung mit der Verbreitung eines universellen Anspruchs haben. Die chinesische Geschichte kennt solche Erfahrungen nicht, eben weil die Chinesen es niemals versucht haben, ihre eigene Kultur in weltweitem Maßstabe zu verankern. Die Chinesen waren immer Siedler, keine Tierhalter. Die Chinesen konnten niemals weit unterwegs sein, sie hatten im Unterschied zu den nomadischen Völkern keine Transportmittel. Die nomadischen Völker waren die mobilsten und die offensten Völker. Ich sage immer, die nomadischen Völker haben niemals eine geschlossene Gesellschaft gebildet. Sie waren immer offen für andere Einflüsse, für andere Zivilisationen. Die nomadischen Völker kamen sehr leicht in Kontakt mit anderen Völkern und Nationen. Deshalb ist die Mentalität von nomadischen und siedelnden Völkern ziemlich verschieden.
KAI EHLERS: Welche Lehren sind Ihrer Ansicht nach aus dem traditionellen Tengerismus für die heutige Situation der Mongolei zu ziehen?
PROF. BIRA: Ich würde ich sagen, die Mongolen haben eine sehr reiche Erfahrung in Sachen Globalisierung. Wir hatten unsere eigenen reichen Erfahrungen. Das ist der Grund, warum ich jetzt über den Tengerismus spreche. Die Menschheit sollte Erfahrungen aus der mongolischen Geschichte des 13. und des 14. Jahrhunderts ziehen: Es gab einen realen Tengerismus, es gab so etwas wie eine Prozess der weltweiten „Verhimmlichung“ der Welt, denn die mongolische Botschaft war, alle Völker und Nationen der Welt sollten unter einer politischen Macht vereint sein, alle Völker, die es unter dem Himmel gibt. Das war die Hauptphilosophie der Mongolen.
Diese Vorstellungen wurden natürlich gewaltsam implementiert, mit militärischer Gewalt, hauptsächlich, aber nach der Vereinigung vieler Nationen gab es Interaktionen mit Europa, gab es Beziehungen zwischen verschiedenen Völkern Asiens und der Mongolei, es gab eine freie Bewegung zwischen den Völkern und freien Handel, das dem mongolischen „urtko“-System, dem mit Pferdestationen verbundenen Kommunikationssystem des mongolischen Reiches zu verdanken war. Und hinter dem Tengerismus standen natürlich wirtschaftliche Faktoren, wirtschaftliche Interessen. Die herrschende mongolische Klasse wollte reich werden, und wollte den Zugang zum Reichtum anderer Länder haben. Aber das Interessanteste an all dem ist, dass Tschingis Chan und seine Nachfolger ihre wirtschaftlichen Interessen weitgehend durch die Philosophie begründen, legitimieren, stützen konnten, durch eine intellektuell sehr hoch entwickelte Lehre des Tengerismus.
Und wie ist es heute? Was ist Globalisierung? Da gibt es ebenfalls wirtschaftliche Interessen. Transnationale Korporationen, wie Sie es nennen, nationale Korporationen sind sehr interessiert. Das ist die Tatsache. Die weltweiten Beziehungen, die Globalisierung bringt den Völkern viel Gutes, viele Werte, besonders den unterentwickelten Völker, Internet, Technologie usw., Auch das stimmt. Aber Seite an Seite mit den positiven Effekten gibt es auch sehr viele negative. Das ist der Grund, warum die Menschheit von dieser Entwicklung sehr betroffen ist. Das ist auch der Grund, warum die Doktrin der Globalisierung heute verbessert werden muss in gewisser Weise, in Hinsicht auf Moral, auf kulturelle Werte, spirituelle Werte usw. Die Globalisierung wird keine großen Ergebnisse haben, wenn sie nicht mit spirituellen Werten, mit moralischen werten in Übereinstimmung gebracht werden kann (er sagt: „harmonized“), wenn wir nicht den Unterschied von Religion und Zivilisation anerkennen. Eine der wichtigsten Dinge ist: Globalisierung darf nicht mit Gewalt, Brutalität oder auf ähnlichen Wegen durchgesetzt werden.
KAI EHLERS: Ja, die alten Wege sind nicht mehr gangbar. Darin stimme ich mit Ihnen überein. Welche Rolle könnte die Mongolei also heute in diesem Prozess spielen?
PROF. BIRA: Nun, zuallererst sollte die Mongolei mit anderen unterentwickelten Nationen kooperieren, um ihre einzigartige Kultur zu erhalten, die nomadische Lebensweise, die Werte der nomadischen Kultur und die Werte der Religion und Moralität. Reisende aller Jahrhunderte waren immer sehr inspiriert von der Moral, die sie hier bei den nomadischen Menschen gefunden haben, auch die frühen Christen, die hier das Christentum hier einzuführen versuchten, nachdem sie hier Menschen wie ihre eigenen vorgefunden hatten. Bevor sie hierher kamen, hatten sie keine Vorstellung von Asien; wenn sie an Asien dachten, dann stellten sie sich Herden von Tieren und Wesen mit Hundeköpfen und menschlichen Körpern vor usw. Erst nach dem Kontakt mit den Mongolen bekamen die Europäer ein realistisches Verständnis von asiatischen Menschen, einschließlich der Mongolen. Das ist der positive Effekt des mongolischen Imperiums, obwohl es auch durch Gewalt geschaffen wurde. Die Philosophie der Mongolen war aber eine sehr kosmische; sie wollten die soziale Harmonie. Das ist, was man auch die PAX MONGOLICA nennt.
KAI EHLERS: Wenn wir diese historischen Erfahrungen auf heute beziehen, dann stellt sich mir die Frage: Kann die Mongolei, die jetzt
zwischen China und Russland, zwischen Europa und Amerika, also zwischen allen Interessen und Kulturen liegt, heute eine ähnliche Kraft entwickeln? Diesmal allerdings nicht militärisch, sondern durch ihre andersartige nomadische Kultur, die einen Transformationsraum einer anderen, modisch gesprochen einer nachhaltigen Art von Modernisierung bildet, diesmal als neutraler Katalysator, der einen ruhenden Pol in einer Welt bildet, die sich heute regional und global neu organisiert?
PROF. BIRA: 169 Dies ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke ebenfalls über diese Frage nach. Ich denke; Ja, die Mongolei könnte mit der Hilfe der Vereinten Nationen eine Rolle als neutralisierender Faktor spielen. Und eine Rolle, um die negativen Konsequenzen der Globalisierung zu minimieren. Ich denke, es geht dabei nicht nur um die Mongolei, die als kleine Nation so eine Rolle spielen kann. Das gilt auch für andere kleine Nationen…
KAI EHLERS: Rund um die Mongolei…
PROF. BIRA: Ja, rund um die Mongolei. Und es gilt auch für die weiter entfernten Nationen. Die Mongolei sollte eine führende Rolle dabei übernehmen, andere kleine Nationen zusammenzuführen, um deren einzigartigen Kulturen und Zivilisationen zu schützen. Das ist sehr wichtig. Wenn es diese kleinen Nationen nicht gibt, die sich zusammentun, dann werden wir die soziale und moralische Balance verlieren. Ich wundere mich manchmal darüber, wie sehr Leute sich grämen, wenn eine der bedrohten Pflanzen untergeht; dann heißt es, wir verlieren die ökologische Balance; aber wenn kleine Nationen verschwinden, dann kümmert das kaum irgend jemanden. Das ist sehr befremdlich! Aber es geschieht. Die Völker werden einfach assimiliert, verschwinden. Wenn Globalisierung jedoch in die richtige Richtung gehen soll, dann muss sie alle Menschen, einschließlich die der kleinen Völker, respektieren.
Den Namen Tanger oder Tenger in der Bedeutung der obersten, ursprünglichen Gottheit und alles umfassenden Kraft findet sich übrigens nicht nur im Erbe jener tatarisch-mongolischen Völkerschaften Zentralasiens, des Kaukasus und Mittelrusslands, die mit den Mongolen nach Westen zogen und dann dort siedelten, sondern auch bei den Tschuwaschen an der Wolga, die schon 700 Jahre vorher mit Attila auf dem selben Weg unterwegs waren.
©
Kai Ehlers
Transformationsforscher und Publizist
www.kai-ehlers.de
Einwanderungsland Sibirien? Beispiel Irkutsk.
Einwanderungsland Sibirien?
Beispiel Irkutsk.
Irkutsk ist eine alte russische Kolonialstadt. Sie entstand aus der Zurückdrängung der Taren-Mongolen durch die Truppen des Moskauer Zaren im 17. Jahrhundert, genau 1661. Der Name Irkutsk selbst zeugt von dieser Geschichte. Er geht, so die Erinnerung von mongolischer Seite, auf das mongolische Hauptstadt der Burjätischen autonomen Republik, Ulan Ude, deren Name sich aus dem mongolischen Ulan-Ut herleitet. Das eine bezeichnet einen kräftigen männlichen, das andere einen offenen, weiten Ort. In beiden Orten, östlich und westlich des Baikal, sahen die Nomaden besondere Kräfte des Natur konzentriert. Die russische Geschichte weiß von dieser Namensentwicklung nichts zu berichten.
Bis in die Anfänge des Zwanzigsten Jahrhunderts war Irkutsk eine gemütliche Ansammlung von Holzhäusern am nördlichen Baikalsee. Mit der sowjetischen Entwicklung wurde das alte Zentrum von Industrieanlagen und Plattenbauten eingekreist. Heute ist auch Irkutsk eine der millonenstarken sibirischen Industrieagglomerationen – allerdings immer noch mit einem historischen Kern und malerisch gelegen am Angara, der aus dem Baikal nach Norden fließt, so daß die Stadt seit Jahren wachsenden Zulauf von Touristen aller Ländern hat.
Seit 1991 allerdings, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das hört man von EinwohnerInnen, einheimischen Wissenschaftlern ebenso wie von Geschäftsleuten, verändere Irkutsk sein Gesicht zuehends: Man meint damit die azerbeidschanische Vorstadt, die ethnischen Mafias, vor allem aber den chinesischen Markt. Schanghai, heißt es, liegt heute im Zentrum unserer Stadt.
Seit der Öffnung der Grenzen 1991 wurde und wird Irkutsk zunehmend zu einem Ort der legalen, mehr aber noch der illegalen Einwanderung: Es sind Immigranten aus westlichen Teilen der ehemaligen Union, Armenier, Azerbeidschaner, Tschetschenen; es sind Immigranten aus den GUS-Ländern Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, auch aus den südlichen Teilen des sibirischen Rusland, Tuwa, Chakasien, Altai, vor allem aber sind es Chinesen, die zu Tausenden als Händler und Arbeitsimmigranten in die Stadt und in den Regierungsbezirk Irkutsk strömen.
Genaue Zahlen sind naturgemäß nicht bekannt. Die Zahl der legalen Einwanderer hält sich bei einigen zehntausend für Irkutsk in überschaubaren Grenzen, heißt es in der Gouvernementsverwaltung. Über die illegalen Zuwanderer, die von ethnischen Schlepperbanden ins Land geschleust werden, liegen keine Zahlen vor. Die weitaus größte Gruppe, so viel zeigt schon der Augenschein, stellen jedoch die Chinesen, die scharenweise und in wachsendem Masse ins Land kommen.
Genaue Angaben sind schon deswegen nicht möglich, weil die Mehrheit dieser Menschen unangemeldet in der Stadt und im Land Irkutsk lebt – wie auch in den angrenzenden Gebieten. Zudem ist – vornehmlich bei den chinesischen Immigraten – die Fluktuation sehr stark. Manche reisen – mit zeitlich begrenzten Visen von drei Monaten – mehrmals im Jahr ein und wieder aus; andere bleiben nach Ablauf der drei Monate illegal im Lande, wieder andere kommen völlig ohne legale Papiere oder benutzen die ihrer Verwandten. Die Verwaltung, des Chnesischen nicht mächtig, ist nicht in der Lage diese Vorgänge zu kontrollieren.
Vorsichtige Schätzungen gehen für den gesamten sibirischen und fern-östlichen Raum von gut einer Million chinesischer Immigranten aus. Andere, bemerkenswerter Weise, moskauer Angaben liegen bei sechs Millionen. So oder so: Der objektive Druck, den die 1,2 Milliarden starke chinesische Bevölkerung auf den mit 20 Millionen vergleichsweise unterbesiedelten sibirischen und fern-östlichen Raum ausübt, ist unübersehbar.
In der Bewertung dieser Entwicklung ist man vor Ort jedoch erstaunlich nüchtern: Prof. Djadlow von der historischen Fakultät der Stadt Irkutsk beispielsweise, Spezialist für die Entwicklung von Diasporen, insbesondere der chinesischen, deren Entstehung er seit Jahren mit mehreren Forschungsprojekten verfolgt, sieht keine aktuelle Bedrohung des russischen Lebensraumes durch die Immigration, auch nicht durch die chinesische. Er weist vielmehr auf die unterschiedlichen Phasen hin, welche die Immigration, insonderheit die chinesische, seit 1991 durchlaufen habe:
1991 bis 1993, so der Professor, habe die Immigration durch chinesische Kleinhändler Sibirien und den fernen Osten – vielleicht sogar Russland im großen Maßstabe – vor der totalen Katastrophe gerettet, als chinesische Billigstwaren die notdürftigsten Lebensbedürfnisse der russischen Bevölkerung deckten. Zwar habe sich inzwischen ein russischer Markt für gehobene und mittlere Ansprüche herausgebildet, auf dem – Geld vorausgesetzt – alles zu bekommen sei. Für die unteren sozialen Schichten sei der chinesische Billigmarkt jedoch auch heute noch überlebenswichtig.
Zum Zweiten, so der Professor weiter und liegt damit ganz auf der offiziellen Linie der Irkutsker Politik – würden dem russischen, speziell dem sibirisch-fernöstlichen Arbeitsmarkt durch die Immigration die notwendigen, ohne die Immigranten sonst fehlenden Arbeitskräfte zugeführt.
Ganz im Gegensatz nämlich zu den landläufigen, vor allem im Westen verbreiteten Klischés der wachsenden russischen Arbeitslosigkeit, so der Professor, sei der russische Arbeitsmarkt, vor allem der sibirisch-fern-östliche in gefährlichem Maße mit Menschen unterversorgt, die bereit seien, physische Arbeit zu leisten. Die einheimische Bevölkerung verweigere zu weiten Teilen den Einsatz bei physischer Arbeit, sie bewege sich lieber nach Westen, wende sich dem Kommerz, intellektuellen oder dienstleistenden Arbeiten zu. Die physischen Arbeiten würden zunehmend von Immigranten aus dem Süden und dem Osten übernommen – armenische, azerbeidschanische, tschetschenische Bauarbeiter seien heute die Regel, besonders aber die Chinesen, die durch die hohe Arbeitslosigkeit in ihrem Heimatland über die Grenzen getrieben würden und gezwungen seien, jegliche Arbeit anzunehmen, die sich biete.
Bisher, so der Professor – halte sich die ganze Entwicklung daher in Grenzen. Aktuelle Warnungen vor einer „gelben Gefahr“ hält er für Alarmismus. Bisher sei die Immigration weder für Irkutsk noch für andere sibirisch-fern-östliche Städte gefährlich, sondern immer noch nützlich, zumal Ansiedlung, Eigentumserwerb und Einbürgerung durch aktuelle Gesetze sehr erschwert würden. Für die Zukunft allerdings sieht nicht nur der Professor, sondern sehen auch staatliche Organe Probleme: Bei weiterer Zuwanderung von chinesischen Immigranten, ja, deren zu erwartender St eigerung, so befürchtet man, könnte das kulturelle Gleichgewicht der Stadt Irkutsk wie insgesamt Sibiriens verloren gehen, das sich bisher durch eine ausgewogene Vielfalt an Kulturen auszeichnete. In zehn oder fünfzehn Jahren könnte eine Situation entstehen, daß neben der sibirischen nur noch eine weitere Kultur existiere, die chinesische. In einer solchen kulturellen Doppelstruktur aber liege die große Gefahr von Prioritätskonflikten, die es bisher in Irkuts nicht gebe. Wie dieser Gefahr begegnet werden kann – darüber gibt es keinen politischen Konsens. Die Zeit werde es zeigen. Allein darin ist man sich einig.
.
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550

Themenheft 9: „Priemtswo“– Akzeptanz
THEMENHEFT 9:
„Priemtswo“– Akzeptanz
Russland auf dem Weg zu sich selbst – Gespräche über die russische Idee
Dr. Igor Tschubajs,
Professor für Philosophie an der Universität für Völkerfreundschaft in Moskau Im Gespräch mit Kai Ehlers, Hamburg
Gespräch 1 und 2
Von Moskau nach Tscheboksary
Russland im Sommer 2002
Stationen einer Reise
Wo endet Europa? Wo beginnt Asien? Wohin wendet sich Russland nach zwei Jahren autoritärer Modernisierung unter Boris Jelzins Nachfolger Wladimir Putin? Wie orientiert sich Russland heute zwischen Asien und Europa? Welche Bedeutung kommt der Gründung einer euroasiatischen Partei zu, die im Mai den Besuch George W. Bushs in Moskau flankierte? Diesen Fragen gehe ich gegenwärtig in Russland nach. Die Reise führt von Moskau über Tscheboksary an der Wolga, Kasan, Nowosibirsk bis Ulaanbaator und an die russisch-chinesische Grenze.
Moskau, wo ich erste Zwischenstation mache, gibt auf diese Frage nur eine Antwort – die Antwort der Megametropole. Moskau ist nicht Russland. In Moskau stellt sich die Frage „Asien oder Europa“ zwar auch, aber hier klärt sie sich nicht: Moskau ist Zentrum, in Moskau halten sich die unterschiedlichen Einflüsse die Waage, Moskau ist eine Welt für sich, ein einziger Marktplatz heute, der eigenen Gesetzen gehorcht.
Dann aber am nächsten Tag Tscheboksary, die Hauptstadt der autonomen Republik Tschuwaschien an der mittleren Wolga: Auch hier ist die Modernisierung unübersehbar. Aus dem hässlichen Entlein einer mittleren sowjetischen Industriestadt, die noch vor wenigen Jahren an den Folgen der Krise zu ersticken drohte, ist ein geputzter Ort geworden, der sich anschickt, westliche Abenteuer-Touristen auf den Wolgasee zu locken, welcher aus der Aufstauung der Wolga hier in den letzten zehn Jahren entstanden ist. In den Straßen Tscheboksarys westliche Automarken, in den Geschäften westliche Preise, in den Büros Computer. Kurz, man darf sich auch in Tscheboksary an der Wolga als Westler wie zuhause fühlen. Es geht, wie es scheint, alles seinen kapitalistischen Gang. Putins autoritäre Modernisierung trägt ihre Früchte.
Aber dann ist da die Sache mit dem Bier: Bier ist Tschuwaschiens Nationalgetränk; Hopfen und Malz sind sein nationaler Reichtum. Über das ganze Land ziehen sich die großen Hopfenstaffagen. Nicht verwunderlich also, daß Bier überall angeboten wird. Doch das Ausmaß! Rundum Menschen mit der Flasche in der Hand, junge vor allem, viele Betrunkene.
Wer nach den Gründen dafür fragt, erfährt, dass die tschuwaschische Republik gewissermaßen im Biernotstand lebt. Die republikanische Verwaltung hat Bier zum nationalen Exportschlager in andere russische Republiken und ins Ausland machen wollen. Aber der Absatz stockt. Das Bier muss im Lande verbraucht werden. Der tschuwaschische Präsident selbst wirbt im Fernsehen für den nationalen Bierkonsum. Die Folgen sind unübersehbar. Die tschuwaschische, vor allem männliche Jugend säuft sich um ihre Gesundheit.
Wer ins „Tschuwaschische Kulturzentrum“ geht, wird mit weiteren nationalen Notständen konfrontiert, die sich nicht auf den nationalen Bierkonsum beschränken: Michael Juchma, vielfach prämiierter tschuwaschischer Volksschriftsteller, Leiter des Zentrums ist verzweifelt: Die „Bewegung der nationalen Wiedergeburt“, die unter Michael Gorbatschow mit großen Hoffnungen auf eine eigenständige Entwicklung des tschuwaschischen Volkes entstand, noch durch Jelzins Aufforderung an die Völker der Sowjetunion, sich so viel Souveränität zu nehmen, wie sie brauchen, verstärkt wurde, siecht unter dem Druck der von Wladimir Putin neuerlich ausgehenden Zentralisierung und damit verbundenen Russifizierung des Landes dahin. Das tschuwaschische Zentrum, seinerzeit von Perestroika-Demokraten gegründet, bettelt heute umsonst um Unterstützung. Die tschuwaschische Regierung gibt keinen Rubel; sie hat sich voll und ganz Wladimir Putins Kurs unterworfen.
Selbst die Türkei, die den turksprachigen Schriftsteller Michail Juchma als wichtigern Partner umwarb, lässt ihn heute gnadenlos abblitzen. Die Zeiten, in denen es opportun war, innerrussische Souveränitätsbewegungen von außen zu unterstützen, weil man sich davon Einfluss auf ein zerfallendes Russland versprechen konnte, scheinen für´s Erste vorbei. Heute finden sich Russland ebenso wie die Türkei im Bündnis gegen den internationalen Terrorismus. Das verpflichtet zur Zurückhaltung gegenüber innerrussischen, wie es dort heißt, „nationalen“ Souveränitätsbestrebungen.
Eher schon ist die Befürchtung von Michael Juchma und den Seinen berechtigt, dass sie demnächst Objekte des soeben von der russischen Staatsduma beschlossenen Gesetzes gegen Extremismus werden könnten, ohne dass sich von außen Proteste dagegen erheben. Formal mit dem notwendigen Vorgehen gegen rassistische Umtriebe von Nazi-Skinheads und offenen faschistischen Gruppen wie die der „Russischen Nationalen Einheit“ (RNE) begründet, lässt die Praxis der russischen Ordnungskräfte befürchten, dass die eigentlichen Adressaten die ethnischen Minderheiten selbst sein könnten, die angeblich durch das Gesetz geschützt werden sollen. Diese Sorgen haben nicht nur Vertreter der in die Isolation geratenen ethnischen Gruppen, die schon mehr als einmal in letzter Zeit vor den Inlandgeheimdienst FSB (den erneuerten KGB) vorgeladen wurden. Auch die sozial-liberale Partei „Jabloko“, die einzige oppositionelle Kraft in der Moskauer Staatsduma, lehnte eine Zustimmung zu dem neuen Gesetz mit Hinweis auf diese Vorgänge ab. Die einzige Hoffnung der ethnischen Minderheiten liegt darin, paradox wie immer wieder in Russland, dass auch dieses Gesetz nicht das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist, weil es vor Ort schlichtweg nicht befolgt werden könnte.
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550
Eurasische Integration: Antwort an Curt Jankowski
Curt Jankowski fragte:
Wie wird Eurasien strukturiert sei?
Wenn Asien und Europa enger zusammenrücken, werden irgendwann vielleicht auch einmal gemeinsame Strukturen entstehen. Natürlich erst im russischen Raum und dann zwischen Rußland und der EU. Das kann dauern, aber irgendwann stellt sich die Frage nach der Strukturierung dieser Zusammenarbeit auf dem riesigen Kontinent. Gibt es da schon jemand, der sich Gedanken gemacht hat, egal ob sie ausgegoren sind oder nicht? Ich habe leider kein E-Mail, gehöre schon zu den älteren Semestern. Können Sie bitte hier antworten? Es wird mir dann mitgeteilt. Vielen Dank, Ihr C. Jankowski.
Kai Ehlers antwortete:
Lieber C. Jakowski,
wie Eurasien strukturiert sein wird kann heute natürlich niemand beantworten.
Ich sehe es so, daß entscheidende Veränderungen der globalen Neuordnung mit Veränderungen mit Wachstumsprozessen auf dem euro-asiatischen Kontinent zusammenhängen. Der eine Prozess ist die die Entwicklung der Europäischen Union mit der Kernmacht Deutschland und deren tendenzielle Abkoppelung von den USA, ein zweiter die Herausbildung einer asiatischen Union mit der Kernmacht China, ein dritter die Herausbildung einer russischen Union und ein vierter die einer zusammenhängenden arabischen Welt. Alle diese Prozesse finden bereits statt, wenn auch in unterschiedlichen Stadien ihrer Herausbildung, und die darin in Keimen angelegten plurale Kräfteverhältnisse stehen in Konkurrenz zu jeglicher Form einer unilateralen Weltordnung – sei sie von den USA oder sonst jemanden beansprucht. Dazu kommen regionale Integrationsprozesse in Südamerika und Afrika, die noch sehr in den Anfügen stecken, aber als weitere Elemente der Pluralisierung mit in diesen Zusammenhang hineinwirken. Aus dieser Konstellation heraus erhellt sich die gegenwärtig zu beobachtende Politik der USA (Afghanistan, Irak, atomare Bedrohung der „Schurkenstaaten“ Iran, Nordkorea, Syrien, Libyen), die praktisch darauf zielt, einen solchen weltweiten pluralen Prozess gleichberechtigter Partner – in den sie sich einordnen müssten – unter dem Anspruch der „einzig verbliebenen Weltmacht“ zu verhindern. Im Klartext bedeutet das Krieg – nicht nur gegen den Irak, sondern es bedeutet einen langandauernden, möglicherweise vernichtenden Krieg gegen die potentiellen Herausforderer, bzw. deren Parteigänger, wenn es der „internationalen Gemeinschaft“, das heißt, der Allianz, bzw. verschiedenen Allianzen der neuen Mächte nicht gelingt, die vernünftigen Teile der amerikanischen Gesellschaft zu einer Einsicht in die neu herangewachsenen Kräfteverhältnisse auf unseren Globus zu bewegen, vielleicht auch zu zwingen, indem sie der Globalisierung imperialistischer Ansprüche durch die USA die Gefolgschaft verweigern. Eine solche Verweigerung beginnt mit dem NEIN zum Krieg gegen den Irak und zu militärischen Lösungen des Terrorismusproblems und setzt sich fort in der gezielten Integration und Stärkung von global agierenden Regionalmächten und deren kooperativer Beziehung zueinander.
Soweit, lieber C. Jakowski, meine Sicht der heutigen Entwicklung, in der China, Russland und Europa und die Herausbildung ihrer von zivilen, kooperativen Beziehungen zwischen ihnen als Gegengewicht zur einseitigen Orientierung auf eine militärische Weltmacht USA eine entscheidende Rolle spielen. Deutschland nimmt darin in der Verarbeitung seiner Rolle im ersten Weltkrieg und seiner faschistischen Vergangenheit und als Herz des Europäischen Einigungsprozesses einen wesentlichen Platz ein. Die strategischen Entwicklungslinien der neuen pluralen Weltordnung Ordnung herauszuarbeiten und sich für deren Verwirklichung einzusetzen, halte ich daher für eine der wesentlichen Aufgaben der kritischen Intelligenz unseres Landes.
Zu einem Artikel „Euroasiatismus im heutigen russland“ in Eurasisches Magazin 07-02
Was will Europa in Zentralasien?
Was will Europa in Zentralasien?
Erzähler:
Seit dem 11.09.2001 sind westliche Truppen in Zentralasien stationiert – zunächst im Krieg gegen die Taliban, dann zur Stabilisierung der fast vollständig zerstörten Hauptstadt Afghanistans, Kabul. Das Hauptkontingent der Truppen stellen die USA, deren Soldaten weiterhin in Afghanistan kämpfen. Inzwischen sind sie auch in Usbekistan stationiert. Aber auch Europa ist präsent: Europäische Spezialtruppen unterstützen die USA im Kampf gegen die Reste der Al Quaida und versprengte Taliban-Kämpfer. Vor allem aber im zivilen Bereich übernimmt Europa seinen Part: Abgeordnete der europäischen Kommission, ebenso der deutsche Außenminister Joschka Fischer bereisten wiederholt in letzter Zeit große und kleine zentralasiatische Staaten. Die Konferenz zur Einsetzung einer provisorischen Nachkriegsregierung in Afghanistan wurde von Deutschland ausgerichtet. Bundeskanzler Gerhard Schröder war der erste westliche Politiker, der Kabul nach dem Krieg besuchte – in seinem Gefolge Vertreter der Wirtschaft und kein geringerer als Fußballkaiser Franz Beckenbauer. Die USA erwarten einen Stabilitätsbeitrag von den Europäern für Zentralasien in Höhe mehrerer Milliarden Euro und weitere militärische Unterstützung. Bei seinem Europa-Besuch im Mai des Jahres beschwor der US-Präsident George W. Bush vor dem deutschen Bundestag die Einheit der westlichen Interessen. Er sagte:
Zitat 1: George W. Bush:
“Gemeinsam widersetzen wir uns einem Feind, der sich an Gewalt und dem Schmerz von Unschuldigen nährt. Die Terroristen werden von ihren Hassgefühlen bestimmt: Sie hassen Demokratie und Toleranz und Meinungsfreiheit und Frauen und Juden und Christen und alle Muslime, die nicht ihrer Meinung sind. Andere töteten im Namen der Reinheit der Rasse oder des Klassenkampfs. Diese Feinde töten im Namen einer falschen Reinheit, sie pervertieren den Glauben, den sie zu haben behaupten. In diesem Krieg verteidigen wir nicht nur die vereinigten Staaten oder Europa, wir verteidigen die Zivilisation selbst.“
Erzähler:
Europa, das ist für den US-Präsidenten auch Osteuropa und darüber hinaus ebenso das Russland Wladimir Putins. So ermahnte er die Abgeordneten des deutschen Bundestages:
Zitat 2: G.W. Bush
“Eine weitere gemeinsame Mission ist die Ermutigung des russischen Volkes, seine Zukunft in Europa zu suchen – und zusammen mit Amerika.“
Erzähler:
Das neue NATO-Revirement, das Russland als fast gleichberechtigtes Mitglied in einen NATO-Kooperationsrat aufnimmt, soll diese Linie unterstreichen. Nicht Konkurrenz, sondern Kooperation bestimme die Beziehungen zwischen den USA und diesem großen Europa, versicherte der US-Präsident während seiner Europareise im Mai 2002 in Berlin, danach auch in Moskau, Paris und schließlich noch einmal beim NATO-Gipfel in Rom:
Zitat 3: G.W. Bush
„Wenn die Einigung Europas voranschreitet, nimmt die Sicherheit in Europa und Amerika zu. Mit der Integration Ihrer Märkte und einer gemeinsamen Währung in der Europäischen Union schaffen Sie die Voraussetzungen für Sicherheit und gemeinsame Zielsetzungen. In allen diesen Schritten sehen die Vereinigten Staaten nicht den Aufstieg eines Rivalen, sondern das Ende alter Feindseligkeiten.“
Erzähler:
USA, Europa, Russland – eine große Staaten-Familie unter väterlicher Obhut der USA? Die von den USA geführte „Allianz gegen den Terror“ eine Wertegemeinschaft im gemeinsamen Interesse, „die Tyrannei und das Böse zu bekämpfen?“ Die NATO auf dem Weg zu einer, wie es manche nennen, paneuropäischen Polizei? Ist das die Wirklichkeit?
Selbstverständlich ist es das nicht. Es ist nur die aktuelle Medienversion einer lang angelegten Strategie US-amerikanischer Vorherrschaft. Wer wissen will, welche langfristigen Interessen die USA heute nach Zentralasien führen, welche Rolle sie Europa und welche sie Russland dabei zuweisen, findet Aufklärung bei dem US-Altstrategen Zbigniew Brzezinski. Er war einst Sicherheitsberater bei Präsident Jimmy Carter und ist noch heute neben Henry Kissinger und Samuel P. Huntington einer der grauen Eminenzen in der Welt der berüchtigten Think Tanks, in denen die US-Globalstrategie ausgebrütet wird: Sein Vorwort zu seinem Buch „Die einzige Weltmacht“, herausgegeben im Jahre 1998, also weit vor der angeblichen Wende der Weltpolitik vom 11.9.2001, beginnt Brzezinski mit der bekmerkenswerten Feststellung :
Zitat 4: Zbigniew Brzezinski
„Seit den Anfängen der Kontinente übergreifenden politischen Beziehungen vor etwa fünfhundert Jahren ist Eurasien stets das Machtzentrum der Welt gewesen.“
Erzähler:
Im letzten Jahrhundert, so Brzezinski weiter, habe sich die Weltlage jedoch grundlegend verändert. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte sei ein außer-eurasischer Staat nicht nur als Schiedsrichter eurasischer Machtverhältnisse, sondern als die einzige und im Grunde erste Weltmacht auf den Plan getreten. Gemeint sind die USA. Eurasien habe dadurch seine geopolitische Bedeutung jedoch keineswegs verloren:
Zitat 5: Zbigniew Brzezinski
„In seiner westlichen Randzone – Europa – ballt sich noch immer ein Großteil der politischen und wirtschaftlichen Macht der Erde zusammen; der Osten des Kontinents – also Asien – ist seit einiger Zeit zu einem wichtigen Zentrum wirtschaftlichen Wachstums geworden und gewinnt zunehmend an politischem Einfluss. Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen können, hängt aber davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird – und ob es dort das Aufkommen einer dominierenden, gegnerischen Macht verhindern kann.“
Erzähler:
Nach dieser Klarstellung fährt Brzezinski fährt fort:
Zitat 6: Zbigniew Brzezinski
„Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. Erst 1940 hatten sich zwei Aspiranten auf die Weltmacht, Adolf Hitler und Joseph Stalin, expressis verbis darauf verständigt, (während der Geheimverhandlungen im November jenes Jahres), dass Amerika von Eurasien ferngehalten werden sollte. Jedem der beiden war klar, dass seine Weltmachtpläne vereitelt würden, sollte Amerika auf dem eurasischen Kontinent Fuß fassen. Beide waren sich einig in der Auffassung, dass Eurasien der Mittelpunkt der Welt sei und mithin derjenige, der Eurasien beherrsche, die Welt beherrsche.“
Erzähler:
Heute, ein halbes Jahrhundert später, stelle sich die Frage neu, nämlich: Werde Amerikas Dominanz in Eurasien von Dauer sein und zu welchen Zwecken könnte sie genutzt werden? Brzezinskis Antwort auf diese Frage verbindet amerikanische Freiheitspropaganda und machtpolitischen Pragmatismus auf atemberaubend offene Weise. Manche Menschen interpretieren diese Offenheit sogar als Zeichen demokratischer Kultur:
Zitat 7: Zbigniew Brzezinski:
„Amerikanische Politik sollte letzten Endes von der Vision einer besseren Welt getragen sein, einer Vision, im Einklang mit langfristigen Trends sowie den fundamentalen Interessen der Menschheit eine auf wirksamer Zusammenarbeit beruhende Weltgemeinschaft zu gestalten. Aber bis es soweit ist, lautet das Gebot, keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen, der den eurasischen Kontinent unter seine Herrschaft bringen und damit auch für Amerika eine Bedrohung sein könnte.“
Erzähler:
Von Zbigniew Brzezinski stammt die Definition des zentral-asiatischen Raumes als „Eurasischer Balkan“. Er meint damit die Region, die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach 1991 als Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS hervorgegangen ist. Brzezinski betrachtet dieses Gebiet als herrschaftsfreie Zone, die einer neuen ordnenden Führung bedürfe – der amerikanischen, die das Gebiet für die Welt offen halten müsse. Auf jeden Fall müsse eine neue russische Monopolisierung des Gebietes verhindert werden:
Zitat 8: Zbigniew Brzezinski:
„Es ist dieses wohlvertraute Phänomen des Machtvakuums mit der ihm eigenen Sogwirkung, das die Bezeichnung eurasischer Balkan rechtfertigt: Im Kampf um die Vormacht in Europa winkte der traditionelle Balkan als geopolitische Beute. Geopolitisch interessant ist aber auch der eurasische Balkan, den die künftigen Transportwege, die zwischen den reichsten und produktivsten westlichen und östlichen Randzonen Eurasiens bessere Verbindungen herstellen sollen, durchziehen werden. Außerdem kommt ihm sicherheitspolitische Bedeutung zu, weil mindestens drei seiner unmittelbaren und mächtigsten Nachbarn von alters her Absichten darauf hegen, und auch China ein immer größeres politisches Interesse an der Region zu erkennen gibt.“
Erzähler:
Die „unmittelbaren mächtigsten Nachbarn“, von denen Brzezinski spricht, sind Russland, der Iran – und nicht zu vergessen Europa. Neuerdings tritt, wie auch Brzezinski wiederholt anmerkt, China hinzu. Dies seien mächtige Gründe für ein ausgleichendes Eingreifen der USA, meint Brzezinski. Noch viel wichtiger aber sei der eurasische Balkan aus einem anderen weiteren Grund, nämlich:
Zitat 9: Zbigniew Brzezinski:
„Weil er sich zu einem ökonomischen Filetstück entwickeln könnte – konzentrieren sich in diesen Regionen doch ungeheure Erdgas- und Erdölvorkommen, von wichtigen Mineralien einschließlich Gold – ganz zu schweigen.“
Erzähler:
Der weltweite Energieverbrauch, so beschreibt Brzezinski die Qualität dieses Filetstückes, werde sich in den nächsten zwei oder drei Jahrzehnten enorm erhöhen. Er zitiert Schätzungen des US-Departments of Energy, denen zufolge die globale Nachfrage bis zum Jahr 2015 um voraussichtlich mehr als fünfzig Prozent steigen werde. Die größte Zunahme werde dabei für den Fernen Osten, also vorrangig für China erwartet. Schon jetzt rufe der wirtschaftliche Aufschwung in Asien einen massiven Ansturm auf die Erforschung und Ausbeutung neuer Energievorkommen hervor, und es sei bekannt, dass die zentralasiatische Region und das kaspische Becken über erdgas- und Erdölvorräte verfügten, die jene Kuwaits, des Golfes von Mexiko oder der Nordsee in den Schatten stellten.
Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten und an ihrem Reichtum teilzuhaben, so Brzezinski, seien Ziele, die nationale Ambitionen weckten, Gruppeninteressen anregten, historische Ansprüche wieder aktualisierten, imperiale Bestrebungen wieder aufleben ließen und internationale Rivalitäten entfachten. Kurz, der US-Stratege aktualisiert die Grundzüge des „Great Game“, das am Ende des 19. Jahrhunderts um die Vorherrschaft über diese Region zwischen den großen imperialen Blöcken Russlands und Englands ausgetragen wurde und das nun, nach dem Ende der sowjetischen Alleinherrschaft über das Gebiet, erneut anstehe. Brisanter werde die Situation noch dadurch, setzt er hinzu, dass die Region nicht nur ein Machtvakuum darstelle, sondern auch intern instabil sei. Jeder der dortigen Staaten habe ernste innenpolitische Schwierigkeiten, die einzelnen Staatsgrenzen seien entweder von Gebietsansprüchen ihrer Nachbarn gefährdet oder sie lägen in ethnischen Problemzonen; nur wenige seien bevölkerungsmäßig homogen, einige seien sogar in gewalttätige Auseinandersetzungen territorialer, ethnischer oder religiöser Art verwickelt. Ein Eingreifen der „einzigen Weltmacht“, ist aus Zbigniew Brzezinskis Sicht daher nicht nur möglich, sondern unvermeidlich. Die Methoden, wie das zu geschehen habe, skizziert er wie folgt:
Zitat 10: Zbigniew Brzezinski:
„Die USA sind zwar weit weg, haben aber starkes Interesse an der Erhaltung eines geopolitischen Pluralismus im postsowjetischen Asien.“
Erzähler:
„Erhaltung des Pluralismus“ – das beinhaltet nicht mehr und nicht weniger als die alte imperiale Strategie des „Teile und Herrsche“ im neuen Gewande, dieses mal in dem einer globalen US-Hegemonie. Es geht um den Zugriff der USA auf die Naturreichtümer Euroasiens, um Eingrenzung möglicher Konkurrenten, insbesondere Russlands.
Zitat 11: Zbigniew Brzezinski:
„Neben seinen weiterreichenden geostrategischen Zielen in Eurasien vertritt Amerika auch ein eigenes wachsendes ökonomisches Interesse, wie auch das Europas und des Fernen Ostens, an einem unbehinderten Zugang zu dieser dem Westen bisher verschlossenen Region. In erster Linie geht es jedoch um Zugang zur Region, über den bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion Moskau allein verfügen konnte.“
Erzähler:
In dieser Weltsicht, auch wenn sie im Namen der Weltgemeinschaft propagiert wird, nehmen Europa ebenso wie der „Ferne Osten“ lediglich die Rolle von „Randzonen“ Euroasiens ein, Europa ist für Brzezinski der „demokratische Brückenkopf“ im Westen, Japan und Korea der „fernöstliche Anker“, alle sind sie jedoch „Vasallen“, die in die hegemoniale Strategie der USA einzubinden sind. Russland fungiert unter der Rubrik des „Schwarzen Lochs“ im Zentrum Euroasiens, das neutralisiert werden müsse. Nicht nur der amerikanischen Militär- und Wirtschaftsmacht, sondern auch der amerikanischen Kultur könne auf Dauer keine heutige Gesellschaft widerstehen. Ergebnis werde eine Globalisierung des „American way of life“ sein, meint Brzezinski.
Er schließt sein Buch mit dem visionären Satz:
Zitat 12: Zbigniew Brzezinski
„Im Laufe der nächsten Jahrzehnte könnte somit eine funktionierende Struktur weltweiter Zusammenarbeit, die auf den geopolitischen Gegebenheiten gründet, entstehen und allmählich die Insignien des derzeitigen Herrschers der Welt annehmen, der vorerst noch die Last der Verantwortung für die Stabilität und den Frieden in der Welt trägt. Ein geostrategischer Erfolg in dieser Zielsetzung wäre dann die durchaus angemessene Erbschaft, die Amerika als erst, einzige und letzte echte Supermacht der Nachwelt hinterlassen würde.“
Regie: Hier evtl. Musik
Erzähler:
„Hegemonie neuen Typs“, „eurasisches Schachbrett“, „demokratischer Brückenkopf Europa“, „Schwarzes Loch Russland“, „Eurasischer Balkan“ und „Fernöstlicher Anker“ – das sind die Schlagworte, die US-Stratege Zbigniew Brzezinski der Welt liefert. US-Präsident G.W. Bush bemüht sich gegenwärtig, sie in praktische Politik umzusetzen. Die von ihm begründete „Allianz gegen den Terrorismus“ lebt von Brzezinskis Geiste. Ganz offensichtlich, soviel ist unbestreitbar, beschreibt diese Strategie eine mögliche Sicht der Wirklichkeit: In Bezug auf Russland und China ist klar, warum diese Länder sich zur Zeit in diese Strategie einbinden lassen. Ihre Führungen erhoffen sich von einer Unterstützung der USA eine langfristige wirtschaftliche Stärkung und freie Hand gegen separatistische Tendenzen in ihren sich transformierenden und auseinanderstrebenden Imperien. Im übrigen aber gebe man sich, was die Westorientierung Wladimir Putins betrifft, keinen falschen Vorstellung hin. Wladimir Putin wiederholt immer wieder, gerade nach vorangegangenen Verbeugungen gegen Westen, was er schon zu seinem Amtsantritt formulierte:
Zitat 13: Wladimir Putin
„Russland hat sich immer als euroasiatisches Land gefühlt. Wir haben nie vergessen, dass ein grundlegender Teil unseres Territoriums sich in Asien befindet. Die Wahrheit ist, das muss man ehrlich sagen, dass wir dieses Vermögen nicht immer genutzt haben. Ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir zusammen mit den Ländern der asiatisch-pazifischen Region von den Worten zur Tat schreiten – die Wirtschaft entwickeln, ebenso politische und andere Verbindungen. Alle Voraussetzungen dafür sind im heutigen Russland gegeben. Für Russland öffnen sich neue Perspektiven im Osten, die wir, daran gibt es keine Zweifel, entwickeln werden. Wir werden uns aktiv an der Umwandlung dieser Region in unser `allgemeines Haus´ beteiligen. Die volle Beteiligung Russlands an der gegenseitigen Wirtschafts-Entwicklung des asiatisch-pazifischen Raumes ist natürlich und unausweichlich. Ist doch Russland ein ganz eigener Knoten der Integration, der Asien, Europa und Amerika miteinander verbindet.“
Erzähler:
Starke politische Strömungen in der politischen Klasse Russlands ebenso wie in der Bevölkerung sind die Basis für diesen Kurs Wladimir Putins. Die Ereignisse des 11.09.2001 haben an dieser Interessenlage nichts geändert. Die russische Föderation ist nach wie vor die zentrale Macht im Herzland Euroasiens – sie ist nicht Europa und nicht Asien, sondern Russland und westliche Hoffnungen, Russland könne seine Orientierung auf eine multipolare Weltordnung zwischen den Polen aufgegeben haben, dürften ziemlich an der Realität vorbeigehen. Ähnliches gilt für China, das zwar seit dem Ende der Sowjetunion eine aktive politische und wirtschaftliche Offensive in Richtung Westen entwickelt. Mehr als sechs Millionen Chinesen haben seitdem die Grenzen zur russischen Föderation überschritten und leben inzwischen dauerhaft auf russischem Gebiet; im Rahmen der „Shanghaier Gruppe“ hat China aber zusammen mit Russland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan und unter den interessierten Augen der übrigen regionalen Anrainer eine regionale Kooperation gestartet. Die GUS-Staaten sehen darin die Möglichkeit, sich von der chinesischen „Wirtschaftslokomotive“ mitnehmen zu lassen. Ziel Chinas ist die Wiederbelebung des transkontinentalen Korridors entlang der ehemaligen Seidenstrasse. Ein Besuch Jiang Tsemins in Deutschland im Frühjahr 2002 dokumentierte diesen Kurs Chinas.
Kurz: China sucht einen direkten Weg nach Europa, aber es versucht sich auch Zugang zu den Ölressourcen am kaspischen Meer zu verschaffen und den zentralasiatischen Raum, einschließlich Russlands, Süd-Asiens und des muslimischen Orients für sich zu öffnen. Auch diese Realität ist nach dem 11.09.2001 nicht anders geworden.
Was die Europäer, allen voran die Deutschen sich von ihrer Präsenz in Zentral-Asien erhoffen, das fasste der deutsche Bundeskanzler nur zwei Monate nach dem 11.09.2001 auf einer Tagung zum 40jährigen Bestehen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in die gut klingenden Worte:
Zitat 14: Gerhard Schröder
„Entwicklungspolitik ist in den letzten Jahren deutlich politischer geworden. Sie geht heute weit über den reinen Ressourcen- und Technologietransfer hinaus. Entwicklungspolitik handelt heute von der Zukunftssicherung in einem sehr globalen Maßstab. Entwicklungspolitik hat deshalb notwendig etwas mit der Durchsetzung der universell geltenden Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz zu tun. Und sie ist – das ist zu unterstreichen – in einer ganz besonderen Weise multilaterale Politik.“
Erzähler:
Diese Zielsetzung folgt dem Muster der amerikanischen Wünsche, dass Amerika von der Vision einer besseren Welt getragen sein sollte – unterscheidet sich von dieser allerdings durch die Betonung des Multilateralen. So wie aber Zbigniew Brzezinski erklärt, bis es soweit sei, dass Amerika wirklich von der Vision einer besseren Welt getragen werde, müssten die USA primär ihre Hegemonie verteidigen, sind auch die Worte des deutschen Kanzlers vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die gewachsene internationale Verantwortung Deutschlands und Europas in Zukunft auch militärische Einsätze notwendig mache, um die Voraussetzungen für die Verwirklichung von Freiheit und Menschenrechten erst einmal zu schaffen.
In den Strategiestuben des deutschen Auswärtigen Amtes wird man deutlicher: Schon während der ersten großen Asien-Rundreise Außenminister Fischers im Mai 2000 veröffentlichte der Leiter des Planungsstabes im Auswärtigen Amt, Staatssekretär Achim Schmillen ein Strategiepapier, in dem er die Europäischen Interessen in Zentralasien skizzierte. Darin spricht der deutsche Staatssekretär genau wie Zbigniew Brzezinski von einer „Balkanisierung Zentralasiens“ und verweist wie dieser auf den – zum Teil noch unerschlossenen – Rohstoffreichtum der Region. Beides zusammen mache Zentralasien zu einem internationalen Sicherheitsrisiko. Er warnt vor einem Desinteresse und vor Tatenlosigkeit Deutschlands und Europas und fordert ein aktives Engagement der Europäer in Zentralasien.
Dafür gibt er, außer dem schon Gesagten, noch eine weitere Begründung, die in bemerkenswerter Weise von amerikanischen Darstellungen abweicht.
Wichtig sei die Region auch, erklärt er:
Zitat 15: Achim Schmillen:
„Zumal es sich nicht nur um ein Gebiet mit vielen Bodenschätzen handelt, sondern um die natürliche Kommunikationsbrücke zwischen Zentralasien, Südasien, China und dem Westen. Das Interesse Europas muss deshalb darin bestehen, dass dieses Gebiet stabilisiert wird.“
Erzähler:
Zwei geopolitische Faktoren sind nach Ansicht des deutschen Staatsekretärs für die Zukunft der Region und für Europa von besonderer Bedeutung:
Zitat 16: Achim Schmillen
„Erstens haben die zentralasiatischen Staaten keinen Zugang zum Meer. Sie brauchen Verbindungs- und Handelswege, um am internationalen Handel teilnehmen zu können. Die Handel- und Routensicherheit kann nur durch Zusammenarbeit zwischen den Staaten geschaffen werden. Zweitens ist die Region eine klassische Pufferzone. Sie trennt Europa vom indischen Subkontinent, von China und Ostasien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die geostrategische Bedeutung der Region künftig die politische, ökonomische und sicherheitspolitische Bedeutung übertreffen wird. Der EU ist daran gelegen, die Energieimporte durch die Erschließung der Erdöl- und Erdgasreserven und der zentralasiatischen Region zu diversifizieren. Europa hat zudem großes Interesse an der Eindämmung der Rauschgiftzufuhr, der organisierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus.“
Erzähler:
„Diversifizieren“, das bedeutet, Europa soll dafür sorgen, dass Öl- und Gasvorkommen der Region nicht von einem einzigen Lieferanten monopolisiert werden können – nicht von Russland, nicht von der Türkei, nicht vom Iran, aber auch nicht von den USA. Europa, so Achim Schmillen, müsse die in der Region aktiven Unternehmen ermuntern, eine zukunftsfähige Öl- und Gasindustrie aufzubauen, sowie, das stellt er besonders heraus, ein multipolares Pipeline-System unter Einschluss russischer Unternehmen. Für diese Politik der Kooperation will man nicht nur Russland und China, sondern auch die Vereinigten Staaten gewinnen, weil sich sonst kein breiter Lösungsansatz finden lasse.
Erzähler:
In weiteren Papieren aus dem Auswärtigen Amt, die – als persönliche Stellungnahmen von Mitgliedern des Planungsstabes deklariert – zeitgleich in österreichischen Militärfachblättern erschienen, werden noch weitere Vorstellungen deutlich. Dort heißt es:
Zitat 17: Auswärtiges Amt
„In der Region sind zwei Drittel aller Weltölreserven und annähernd 40% aller Erdgasreserven konzentriert. Daher gibt es ein vitales Interesse der Industrie- und Schwellenländer an dieser Region. Im Kaspischen Becken wurden beträchtliche Lagerstätten von Erdöl und Erdgas gefunden, und noch größere Mengen werden dort vermutet. Diese Ressourcen sind zwar quantitativ nicht mit denen am Golf vergleichbar, aber doch groß genug, um für die Versorgung Europas relevant zu sein.“
Erzähler:
Ähnliche Verlautbarungen konnte man von dem Kommissar für auswärtige Abgelegenheiten der Europäischen Kommission, dem Schweden Chris Patten hören. Anlässlich eines Besuches der außenpolitischen Troika der Europäischen Union im Kaukasus erklärte er bereits im Februar 2001:
Zitat 18: Christopher Patten, EU-Komissiar:
„Stabilität und wirtschaftlicher Aufschwung in der Region sind für Europa wichtig. Deshalb unterstützt die EU die Staaten der Region und fördert die regionale Zusammenarbeit. So wurden dem Kaukasus in den letzten neun Jahren Finanzhilfen in Höhe von etwa 1 Mrd. Euro gewährt. Im Rahmen des technischen Hilfsprogramms TACIS richteten wir die Transkaukasische Initiative für den Bau von Straßen und Schienen (TRACECA) ein und unterstützten die kaukasischen Länder bei der Durchleitung von Öl und Gas. Insbesondere der kaukasische Korridor, der über die Staaten Georgien, Armenien und Aserbeidschan die schnellste Verbindung zwischen Südeuropa und Zentralasien darstellt, ist hier wichtig. Die EU hilft dem südlichen Kaukasus deshalb seit langem dabei, sein großes Potential als Transitregion für Waren und Energie aus dem Gebiet um das kaspische Meer und Zentralasien noch besser auszuschöpfen.“
Erzähler:
US-Amerikanische und europäische Interessen unterscheiden sich deutlich, wenn es ins Konkrete geht. Im strategischen Bereich schlägt sich diese Differenz in Warnungen der Europäer vor der Wiederholung des „Great Game“, vor der einseitigen Orientierung auf militärische Mittel, in der Kritik an unzurechender humanitäre und kulturelle Unterstützung nieder. Und dies nicht erst seit dem 11.09.2001, auch nicht erst nach dem Sturz der Taliban in Afghanistan, sondern grundsätzlich. In den bereits zitierten inoffiziellen Stellungnahmen aus dem auswärtigen Amt heißt es dazu, obschon zurückhaltend formuliert, unmissverständlich:
Zitat 19: Papier des Auswärtigen Amtes
„Grundsätzlich sind alle für die Großregion wesentlichen staatlichen Akteure in und außerhalb der Region an Stabilität in diesem Raum interessiert. Dabei gibt es jedoch konkurrierende Konzeptionen: Auf der einen Seite stehen Russland und – etwas weniger stark ausgeprägt – die USA und China, die Türkei und der Iran, die ganz im Sinne eines traditionellen Nullsummenspiels in der Tradition des `Great Game´ darauf zielen, ihren Einfluss in der Großregion zu vergrößern oder zumindest zu bewahren. Auf der anderen Seite stehen jene, die an einer Stärkung der Staatlichkeit der Länder der Großregion und an ihrer Kooperation untereinander und innerhalb der Staatenwelt interessiert sind. Das sind zum einen die betroffenen Staaten selbst und zum anderen u.a. – Europa. Prinzipiell können noch Japan, Australien, Südkorea und mit Abstrichen noch Indien dazu gerechnet werden. Der Iran und auch die Türkei könnten unter Umständen dafür gewonnen werden.“
Erzähler:
Amerikanern und Europäern, wenn auch nicht offen als Konkurrenten bezeichnet, werden von den europäischen Strategen unterschiedliche Interessen bescheinigt: Den Zugriff auf die Rohstoffe Zentralasiens wollen sie beide; aber während die USA darüber hinaus vor allem an der Verringerung des russischen Einflusses, der Isolierung des Iran und der Eindämmung Chinas interessiert seien, ziele das europäische Engagement vorrangig auf die Stärkung der Staatlichkeit in den zentralasiatischen Gebieten. Unter dem Stichwort „Stand der bisherigen Bemühungen“ heißt es lapidar:
Zitat 20: AA-Papiere
„Die Länder des Südkaukasus und Zentralasiens erhalten bereits vielfältige Unterstützung von unterschiedlichen Partnern und aus unterschiedlichen Programmen. Diese Aktivitäten sind allerdings beschränkt in ihrer Reichweite und kaum aufeinander abgestimmt. Die wichtigsten sind die Programme der Europäischen Union.“
Erzähler:
Es folgt eine beachtliche Liste: Darauf finden sich Kooperationsabkommen zum Aufbau übergreifender regionaler Infrastrukturen im Rahmen technischer Hilfsprogramme, gesonderte Regionalprogramme, Programme humanitärer Hilfe, weiter Programme der Konfliktregulierung seitens der OSZE, des Europarates und der NATO. Dazu – interessanterweise unter der Rubrik des europäischen Engagements aufgeführt – Programme der UNO für die Armuts- und Wüstenbekämpfung, für den Aufbaus von Wirtschafts- und Finanzinstitutionen. Deutschland im besonderen unterhält mit Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan und sämtlichen Ländern des südlichen Kaukasus Partnerschaften der Entwicklungszusammenarbeit.
Scharf treten die Differenzen zwischen den USA und den Europäern in der Regelung der Nachkriegsordnung Afghanistans hervor. Die unter deutschem Vorsitz, aber von der „Allianz gegen den Terror“ eingesetzte Übergangsregierung Hamid Karzais in Afghanistan erwartet eine Ausweitung der internationalen Schutztruppe über die Grenzen der Hauptstadt Kabul hinaus auf andere afghanische Städte, um eine einigermaßen stabile Entwicklung im heutigen Afghanistan einzuleiten. Die Europäer lassen dazu Bereitschaft erkennen; von der US-Regierung wurde eine solche Ausweitung jedoch abgelehnt. Eine Ausweitung, die auch eine Ausweitung der europäischen Präsenz mit sich brächte, das ist offensichtlich, würde das militärische Machtmonopol beeinträchtigen, das Washington zur Zeit in Afghanistan ausübt, und seinen Plänen für eine weitgehend in den USA ausgebildete, nationale afghanische Armee in die Quere kommen, die als langfristige Stütze für die Ausübung politischen Einflusses dienen soll.
Wie wenig die USA an der Entwicklung einer selbstständigen Staatlichkeit Afghanistans interessiert sind, zeigen die Vorgänge, welche die Einreise des Ex-Königs Mohammad Zahir Schah Anfang April begleiteten.
Ein englischer Journalist berichtete besorgt:
Zitat 21: Englischer Journalist:
„Der afghanische König Mohammad Zahir Schah, 87, der seit 1973 im italienischen Exil lebt, sollte mit großem Bahnhof in der Hauptstadt einziehen. Das italienische Außenministerium organisierte die Reise und bereitete eine Sicherheitseskorte vor. Der Chef der afghanischen Interimsregierung Hamid Karzai, selbst ein Royalist, wollte nach Rom fliegen, um den Monarchen nach Hause zu eskortieren. Eine 12-Zimmer Villa mit Swimming-Pool war als Residenz für den König in Kabul vorbereitet worden. Der US-Botschafter hatte sogar eine Abschiedsparty für ihn gegeben. Doch dann wurde die Reise abgesagt. Die Entscheidung wurde weder in Kabul noch in Italien getroffen, sondern in Washington. Präsident Bush rief den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi an und stellte die Sicherheitsvorkehrungen in Frage; er warnte vor einem möglichen Anschlag auf das Leben des Königs. Washington bestand darauf, Italien müsse die Sicherheit des Königs in Kabul garantieren, und nicht etwa das afghanische Innenministerium. Als Termin wurde der April vorgesehen.“
Erzähler:
Der Vorgang könnte als unbedeutend übergangen werden, zumal der König inzwischen eingereist ist; er zeigte aber, darin ist dem englischen Berichterstatter zuzustimmen, welche politischen Beziehungen heute in Afghanistan existieren:
Zitat 22: Forts. Englischer Journalist
„In allen Fragen, ob groß ob klein, hat Washington das Sagen, wobei die westlichen Alliierten wenig und Karzai überhaupt nicht hinzugezogen werden. Der `Los Angeles Times´ zufolge waren die Führer der Interimsregierung `irritiert und fühlten sich bloßgestellt´. Sie `beschwerten sich, dass sie nichts zu sagen´ hätten, grummelten aber letztlich `lediglich privat über Einmischung von außen´.“
Erzähler:
In der Tat: Die Arbeitsteilung im nach-talibanischen Afghanistan ist exemplarisch: Die USA, unterstützt durch wenige Spezialisten der europäischen Staaten, setzen den Krieg gegen die Reste der Taliban fort, die europäischen Truppen konzentrieren sich auf Polizeiaufgaben in Kabul selbst und die Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Alltagsgütern. Die Tatsache, dass Fußballkaiser Franz Beckenbauer den deutschen Bundeskanzler auf seinem Besuch in Kabul, dem ersten eines westlichen Allianzmitgliedes, begleitete, war kein Zufall, sondern ist als Botschaft gedacht. Sport, Kultur, wirtschaftliche und infrastrukturelle Hilfsprogramme sollen den Willen Deutschlands und mit Deutschland auch der Europäischen Union dokumentieren, den langfristigen Aufbau regionaler Strukturen zu fördern und zu unterstützen. In welchem Maße dies tatsächlich geschieht, das steht auf einem anderen Blatt. So viel aber ist klar: Diese Konzeption folgt einem anderen Interesse als die der USA: Europa ist Teil der multipolaren Realität des euroasiatischen Kontinents, die es aktiv und kooperativ fördern und gestalten muss, um darin zu überleben. Ähnliches gilt für Russland, China, die süd-asiatischen und die muslimisch-orientalischen Staaten. Den USA dagegen reicht es, wie Zbigniew Brzezinki es nennt, die Pluralität des Raumes aufrechtzuerhalten, um ihn als Hegemonialmacht zu beherrschen. Über diese Differenz können auf Dauer keine gemeinsamen Deklarationen hinwegtäuschen. Eine Differenzierung der gegenwärtigen amerikanischen Dominanz in eine multipolare Kooperation verschiedener größerer Mächte ist nur eine Frage der Zeit. Zu hoffen ist, dass sie sich friedlich vollzieht.

Themenheft 8: Moskau – Mythos und Wirklichkeit
THEMENHEFT 8:
Moskau – Mythos und Wirklichkeit
Arbeitsmaterial zum Seminarzyklus des „ifl“
„Reise nach Russland“ zusammengestellt von Kai Ehlers
Fahrplan für die „Reise nach Russland“ S. 1
Valentin Gitermann:
Der Aufstieg Moskaus S. 3
Nationalistische Visionen:
Alexander Dugin: „Idee Moskau“ S. 10
Moskau und Moskowiter im Internet S. 16
Schüleraustausch: Partnerstadt Moskau:
WEBsite des Galiläi-Gymnasiums/Hamm S. 19
Kai Ehlers:
Modell Moskau: „Nado delitsja“ – man muss teilen S. 33
Kai Ehlers: Zur Person S. 37
„Priemstwo“ – Russlands Annäherung an sich selbst
Besetzung:
Erzähler, Übersetzer
Aussprache: Alle russischen Namen und Begriffe sind in phonetischer Umschreibung mit Betonungsangabe wiedergeben.
Anmerkung zu den O-Tönen:
Die Länge der O-Töne ist exakt angegeben. Zähleinheit ist 4,5 sec. pro Zeile plus 4,5 Sec. für die Auf- und 4,5 Sec. für die Ausblendung. Die Töne sind so geschnitten, dass Anfang und – wenn am Schluss aufgeblendet werden soll, dann auch – das Ende in der Regel für jeweils mindestens 4,5 Sec. den (fett) angegebenen Textanfängen oder Textenden entsprechen. Evtl. Schnittstellen (in denen Übersetzung und Ton nicht mehr wortidentisch sind) liegen in der Mitte der Töne. Abweichungen von diesem Schema sind besonders angegeben.
4 Athmos (Musik) und 10 O-Töne – in zwei Einheiten nach einander (A und B zum Verblenden) auf dem Band.
Zur Musik:
Ich stelle mir vor, daß Sie die Musik-Athmo so einspielen, daß der Refrain (der ein Beitrag zum Inhalt des Stückes ist) jeweils in der Aufblendung steht, d.h. am Anfang müssten Sie schauen, wie viel Vorlauf sie nehmen wollen, damit der Ton beimrefrain aufgeblendet werden kann.
Bitte die Schlüsse der O-Töne weich abblenden
Freundliche Grüße
Kai Ehlers
Länge: 27.131 Zeichen
„Priemstwo“ –
Russlands Annäherung sich selbst
Athmo 1: Lied von Juri Ljosa: Lang ist der Weg 2.08.02
Erzähler:
Von schönen Träumen der Kindheit, mit denen er davonschwimmen kann, singt Juri Ljosa. ,
Regie: Zwischendurch hochziehen zum Refrain, dann allmählich abblenden, unterlegen, hochziehen
Erzähler:
„Nu, i pust, budit ni lochki…
„Wenn auch mein Weg nicht leicht sein wird“, heißt es in dem Refrain, „treibt doch mein Floß weiter dahin. Und das ist auch nicht so schlecht.“ Das Lied trifft die russische Befindlichkeit von heute: Die Krise ist schwer zu ertragen, aber die Träume von einem besseren Russland leben doch fort. Wer auf langen Strecken fährt, hat diese Kassette ganz sicher im Sortiment.
Regie: Vorübergehend hochziehen, allmählich abblenden
Erzähler:
Einer der aktivsten Träumer dieser Art ist Igor Tschubajs, Professor für Philosophie Russlands an Moskaus Universität für Völkerfreundschaft. Er arbeitet dort seit Jahren an der Wiederbegegnung Russlands mit sich selbst. Igor Tschubajs ist zugleich ein Beispiel für Russlands Zerrissenheit. Sein Bruder ist jener berüchtigte Anatoly Tschubajs, der als verantwortlicher Minister für Privatisierung zu einer der meist gehassten Figuren der neuen russischen Führung wurde. Er gilt als prinzipienloser Kopist des Westens, der auch sich selbst reichlich bedient hat.
Im ständigen Clinch mit seinem Bruder engagiert Igor Tschubajs sich seit Anfang der 90er für eine Erneuerung des russischen Selbstverständnisses zwischen Modernisierung und Tradition. Er sucht diesen Weg in der Akzeptanz der eigenen, russischen Geschichte. „Russland auf dem Weg zu sich selbst“, heißt eines seiner letzten Bücher. Es erschien 1998. „Priemstwo“, zu deutsch Akzeptanz oder auch Kontinuität, lautet sein Stichwort. Im Sommer 2000 erschien ein Sammelband unter diesem Titel, in dem die Ergebnisse einer internationalen Konferenz zu dieser Frage dokumentiert werden. Eine Bewegung bilde sich unter dieser Fragestellung heraus, erklärt Igor Tschubajs. Sie bekomme für Russland eine ähnliche Bedeutung wie seinerzeit die Frankfurter Schule für Deutschland oder die Wiener Schule für Österreich. In ihr wachse so etwas heran wie eine neue Philosophie Russlands.
Gefragt, was das sei, eine Philosophie Russlands, antwortet er:
O-Ton 1: Igor Tschubajs 1.38.46
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Philosophia Rossii…
„Die Philosophie Russlands, um es ganz knapp zu sagen, ist die Analyse der Schlüsselwerte, die es bei uns gab. Generell ist Russland in vielem spezifisch. In gewisser Hinsicht erinnert es an Frankreich: In Frankreich fand 1789 die bürgerliche Revolution statt: Das Frankreich von 1789 und jenes nach 1789, das sind verschiedene Staaten. Die absolute Mehrheit aller Länder hat eine ungebrochene Geschichte, eine Kontinuität; in Frankreich ist die Geschichte zerrissen, in Russland auch, allerdings nicht räumlich wie in Deutschland während der Teilung, sondern der Zeit nach. Russland wurde der Zeit nach zerrissen: Russland vor 1917 – das ist ein Staat; ein vollkommen anderer ist Russland nach 1917; 1991 brach dann die Sowjetunion, brach das sowjetische System der Werte zusammen, die kommunistische Idee und seit zehn Jahren formen wir nun schon so eine Art neuen Staates, ohne zu wissen, was für ein Staat das ist. Die Philosophie Russlands ist die Analyse der Werte, die es im historischen Russland gab, dem Russland des Oktober. Damals nannte sich das die „Russische Idee“. Es ist die Analyse der Werte, die es in der Sowjetunion gab: Was ist die kommunistische Idee, die kommunistische Ideologie und warum kam anstelle der russischen Idee die kommunistische? Das ist ja nicht zufällig. Das muss man verstehen. Indem man versteht, was die Russische Idee ist, indem man versteht, worin ihre Krise bestand, indem man versteht, warum an ihrer Stelle die kommunistische Idee kam und die kommunistische Ideologie, kann man aus dieser Entwicklung erkennen, was eine neue russische Idee sein kann.“
… russkaja idea.“
Erzähler:
Es war Dostojewski, der den Begriff der „Russischen Idee“ prägte, erklärt Igor Tschubajs. Danach schrieben alle bedeutenderen russischen Philosophen über die Russische Idee, Solowjow, Berdjajew usw., aber keiner bestimmte genau, was das sei. Ihre Methode, so Igor Tschubajs, war die der philosophischen Spekulation. Er versuche jetzt systematisch an das Problem heranzukommen, indem er Forschung auf vier Gebieten betreibe: Studium der russischen Geschichte, Analyse russischer Sprichworte, Analyse russischer Gedichte des 19. Jahrhunderts und schließlich Aufarbeitung der russischen Philosophen, die über die Russische Idee geschrieben hätten. So komme er zu drei Grundwerten, die für die russische Identität bestimmend seien:
O-Ton 2: Igor Tschubajs 0.60.16
Regie: O-Ton (die deutschen Worte) kurz frei stehen lassen, nach Übergang zu Übersetzung abblenden, Sprecher setzt ein, O-Ton unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
Originalton Deutsch, dann weiter Russisch…
„Das ist die Verbreitung, die Ausweitung des Staates, die imperiale Politik, die im 14. Jahrhundert unter Iwan Kalita begann. Vom Moskauer Fürstentum, wo wir uns jetzt befinden, begann die Herrschaft zu expandieren. Diese Expansion kam bis nach Alaska, bis nach Finnland, bis nach Mittelasien, das heißt, die Russen brachten das größte Imperium in der Welt zusammen. Man kann sagen: Das war ein großer Erfolg; viele Völker haben das angestrebt, aber nicht allen gelang die Gründung eines solch großer Herrschaftsbereichs. Das ist das Erste. Das Zweite ist: Ein wichtiger Grundbestandteil der russischen Idee ist die russische Rechtgläubigkeit, die prawoslawische Kultur, die russische orthodoxe Kirche.
Der dritte Grundwert ist der Kollektivismus der Obschtschina, das sind die die auf die alte russische Bauerngemeinschaft zurückgehenden Gemeinschaftstraditionen. „Alle Russen des vierzehnten, fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts“, so Igor Tschubajs, „lebten in Obschtschinas, Gemeinschaften, und waren Kollektivisten. Das also ist die `Russische Idee´: Das Sammeln russischer Erde, die Orthodoxie und der Kollektivismus der Obschtschina.“
… i obschini Kollektivism.“
Erzähler:
Zar, Kirche und Dorfgemeinschaft des alten Russland bildeten eine Einheit, wie sie effektiver nicht sein konnte. In Zar und Kirche verband sich das schier grenzenlose Land mit seinen zahllosen Völkern zu einer zentral geführten Einheit; die selbst verwalteten, aber dem Gutsherrn, dem Landesfürsten, letztlich dem Moskauer Hof verantwortlichen Dorfkollektive sorgten für die Umsetzung des einheitlichen Willens im täglichen Leben. Die Kirche gab ihren Segen dazu, indem sie die gemeineigentümliche Ordnung der Obschtschina zu der von Gott gewollten Form des Lebens erklärte. Den Bauern gab die Obschtschina Schutz, dem Moskauer Hof die Möglichkeit, den Willen des Verwaltung bis in die letzten Winkel des wachsenden Imperiums zu tragen, ohne sich mit den einzelnen „Seelen“, wie der Zar seine Untertanen nannte, befassen zu müssen. Diese Grundlagen, die das Leben des ganzen Landes bestimmten, so Igor Tschubajs, kamen am Ende des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in die Krise. Es war eine Zeit der stürmischen Entwicklung auch für Russland:
O-Ton 3: Igor Tschubajs 1.20.21
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Nietzsche i Dostojewski…
„Nietzsche und Dostojewski beschäftigten sich zur gleichen Zeit mit der Krise des Christentums, Nietzsche bei Ihnen im Westen, Dostojewski hier bei uns in Russland. Nietzsche formulierte: An stelle des alten, kommt ein neuer Über-Mensch, freie Moral anstelle der alten Moral. Die imperiale Politik hatte sich Mitte des 19. Jahrhunderts vollkommen erschöpft. Weiter zu expandieren war nicht möglich. Die orthodoxe Kirche schwankte und der Kollektivismus der Obschtschina begann zu zerfallen. Die Stolypinsche Reform am Anfang des 19. Jahrhunderts orientierte auf private Hofwirtschaft. Kollektivismus gab es in Russland, weil die natürlichen Bedingungen so waren, dass alle einander helfen mussten, um zu überleben und alle Einkünfte wurden gleich gemacht. Am Anfang des Jahrhunderts tauchte neue Technik auf, neues Saatgut, neue Anbaumethoden, so dass das gemeineigentümliche Gleich-Machen schon nicht mehr interessant war. So zerfiel die Einheit von Kollektivismus, Imperium und Kirche. Das Land brauchte dringend eine Reformation – was aber kam, war die Revolution. Darin liegt die russische Tragödie, darin liegt das russische Elend.“
… w etom russiskaja beda.“
Erzähler:
Nicht nur Russland kam in die Krise. Ganz Europa, so Igor Tschubajs, durchlebte gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts eine Ideen- eine Identitätskrise – die Krise des Christentums. Zweitausend Jahre, so der Professor, war das Christentum das Fundament der Welt, war Gott war das Maß der Dinge – nun gab es ihn nicht mehr, jedenfalls nicht mehr verbindlich. Das hatte Folgen – für Russland allerdings andere als für den Westen:
O-Ton 4: Igor Tschubajs 60,01
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
Jesli ransche swjo…
„Wenn man früher alles durch Gott entschied, nun aber kein Gott mehr da war, so brauchte man jetzt einen neuen starken Regulator: So entstanden die totalitären Regimes – in Italien Mussolini, Hitler in Deutschland, Franko in Spanien, Lenin in Russland. Das sind alles Zeugen eines Prozesses. Europa verlor seine Identität, verlor seine Regeln. Einer der Aspekte des zweiten Weltkrieges war, dass zwei Mutanten zusammenstießen, Stalin und Hitler. Stalin siegte – aber die Erfolge des Sieges genießt der Westen, wo das abartige Regime vernichtet wurde. Europa erhielt Demokratie; im Westen brach das ganze unnormale System zusammen, bei uns aber ging das noch fünfzig Jahre lang weiter. Solange wir diese Identitätskrise nicht überwinden, neue Werte finden, die alten, ursprünglichen wider errichten oder reformieren werden wir unsere Probleme nicht lösen.“
…swoi problemi.“
Erzähler:
Vier Wechsel der Werte habe es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gegeben, erklärt Igor Tschubajs: Vom christlichen Kontinuum zum Totalitarismus, vom Totalitarismus zur Demokratie, von der Demokratie zum Globalismus. Obwohl selbst Aktivist der demokratischen Bewegung, die den ungeduldigen Boris Jelzin als Vollstrecker einer radikalen Liberalisierung auf den Thron hob, hat Igor Tschubajs mit der dritten Stufe, dem Übergang zur Freiheit, wie er es nennt, die größten Probleme. Sie gehe heute, meint er, ins Extrem der haltlosen Beliebigkeit, in Russland bis an die Grenze der Selbstvernichtung. Auf die Frage, mit welchen zeitgemäßen Inhalten die drei Grundsäulen der russischen Idee unter solchen Umständen modernisiert werden könnten, antwortet er:
O-Ton 5: Igor Tschubajs 1.15.00
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen, verblenden
Übersetzer:
„A kakoi atwjet…
„Also, welche Antwort? Ich denke `Priemstwo´ ist eine Antwort. Mag sein, dass es Menschen gibt, die etwas prinzipiell Neues ausdenken, ich glaube, dass die religiöse Idee eine Modernisierung braucht; die kann in den Formen der der zeitgenössischen Kultur beschrieben werden. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir sehr unruhige, nicht vorhersagbare Folgen zu tragen haben, denn dann werden wir überhaupt alles zugrunde richten: Kultur, Natur, uns. Nietzsches Meinung, dass aus dem alten Menschen der neue Übermensch ohne Gott hervorgeht, war, meine ich, ein großer Fehler. Dostojewski hat das in Russland alles sehr stark gefühlt. Einer seiner Helden, aus den `Brüdern Karamasow´, sagt: `Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt´. Das ist dieser Satz, der heute vielfach wiederholt wird. Nur würde ich es heute anders sagen: `Wenn es keinen Gott gibt und alles erlaubt ist, dann wird es keinen Menschen mehr geben!´ Wir glauben, wir hätten Gott beiseite geworfen – wir haben uns selbst beiseite geworfen, wir vernichten uns selbst.“
…Sebja unitschtaschajem.“
Athmo 2 – Musik 1.00.10
Regie: Musik verblenden, hochziehen, kurz stehen lassen, allmählich unter dem Erzähler ausblenden
Erzähler:
Eine Erneuerung der angeschlagenen russischen Identität ist notwendig – darin sind sich alle einig. Aber wie? Im Wahljahr 1996, nach dem ersten tschetschenischen Krieg, der Russland in eine tiefe Identitätskrise stürzte, rief Boris Jelzin zu einem öffentlichen Wettbewerb für die Entwicklung einer neuen nationalen Idee auf. Der Erfolg war mäßig. Das Projekt blieb stecken. Statt einer nationalen Idee kam der zweite Krieg in Tschetschenien unter Wladimir Putin. Kein Wunder, kommentiert Igor Tschubajs, eine neue russische Identität lasse sich nicht von oben dekretieren, sie müsse an der Logik der russischen Geschichte in breiter Debatte auf der Basis der Vorarbeit von Spezialisten aller Gebiete herausgearbeitet werden:
Den aktuellen Stand des Problems skizziert er so:
O-Ton 6: Igor Tschubajs 2.15.00
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Besoslowna sewodnja…
„Es ist klar, dass Russland diese Werte heute nicht hat, dass es keine eigene Idee hat. Nach der Auflösung der Sowjetunion, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Idee, haben das natürlich alle begrüßt. Ich selbst war lange Mitglied in der Demokratischen Bewegung, habe mit der Partei gekämpft usw. Das Problem ist ja aber nicht, dass die alten Regeln zerstört wurden, sondern dass es keine neuen gibt und dass die Demokratie keine Demokratie ist: Demokratie – das sind normale Regeln, moralisch, historisch erprobt. All das gibt es bei uns nicht; wir haben keinerlei Regeln. Und in dieser Situation hat Russland vier Varianten, seine Identität wiederherzustellen, vier verschiedene Wege. Erstens: Dieses neue Russland kann einfach eine Neuausgabe der Sowjetunion werden. Zweitens: Das neue Russland kann seine ganze Geschichte beiseite werfen und den Westen kopieren. Das ist die `Union rechter Kräfte´ meines Bruders Anatoly. Aber ich glaube ihnen kein Wort: Sie sagen das eine, denken das zweite und tun das dritte. Nur formal kann man den Westen kopieren. Das ist pervers, lächerlich. Wir haben eine Geschichte von zwölf Jahrhunderten, das ist einer der ältesten Staaten der Welt. Wie kann der einfach seine Geschichte wegwerfen.
Der dritte Weg ist eine Sammlung aus allem: ein bisschen Wiedererrichtung der UdSSR – gerade eben hat man bei uns ein Denkmal für Andropow aufgestellt – ein bisschen Kopie des Westens – Wir haben jetzt einen „Meir“, Bürgermeister, einen „Präsidenten“, ein „Weißes Haus“ – und schliesslich ein bisschen vom alten Russland. Aber so kann man sich nicht bewegen; das ist alles sinnlos. Das einzige, was aus meiner Sicht, akzeptabel ist – die vierte Variante – das ist der Weg der Kontinuität, von „Priemstwo“, der Weg der Akzeptanz, der Wiedervereinigung mit der eigenen Geschichte.“
…. putj samawossedejeninije.“
Erzähler:
Wiedervereinigung mit der eigenen Geschichte, das heißt für Igor Tschubajs: Reformen müssen an gewachsenen Strukturen anknüpfen, die Modernisierung des nachsowjetischen Russland muss sich mit den Fähigkeiten von gestern verbinden. Neue Impulse sind nur möglich durch Aufarbeitung des Alten. Eine vollkommene Wiederherstellung der alten Werte, so Igor Tschubajs, sei selbstverständlich nicht möglich, natürlichmüsse Erneuerung stattfinden, Weiterentwicklung. Für die drei Säulen der russischen Idee sieht er das so:
O-Ton 7: Igor Tschubajs 1.50.00
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Wot, saberannije semel…
„Also, das Sammeln der Erde: Die Expansion hat sich erschöpft, daher ist die Logik der Geschichte, dass die quantitative Entwicklung in eine qualitative übergehen muss. Das muss geschehen: Wenn das quantitative Wachstum sich erschöpft hat, dann muss das qualitative Wachstum beginnen. Jedes Kind beginnt als Kleinkind, wächst dann zwanzig Jahre und danach wächst es nicht mehr physisch, sondern intellektuell. Russland hat nun einen Punkt erreicht, an dem es sich physisch nicht weiter ausdehnen kann. Deshalb geht es nicht um neue Landnahme, nicht um neue Waffen, sondern darum, von quantitativem Wachstum zum qualitativen zu kommen. Wir müssen nicht die Armee verbreitern, nicht die Flotte weiter ausbauen. Natürlich braucht man eine Armee. Ich glaube nicht, dass die Armee überflüssig ist, aber ihr Platz ist begrenzt. Gebraucht wird dagegen Kommunikation; Straßen, Verbindungen, Wissenschaft, neue Technologien, Kultur, Kunst, Bildung, Medizin, das sind die wichtigsten Dinge. Man muss das Haus weiter ausbauen. Im größten Haus der Welt hat man nur die Wände aufgestellt, nun muss es auch von innen eingerichtet werden. Man muss vom Rohbau zum Ausbau voranschreiten. Nicht nötig in Tschetschenien Krieg zu führen, nicht nötig, Afghanistan zu besetzen, nicht nötig, unsere Divisionen in Tadschikistan zu stationieren, nicht nötig weiter zu expandieren, sondern sich mit allen zu befreunden. Nötig mit allen zu sprechen, damit der Frieden auf dem eigenen Territorium garantiert wird, innerhalb der eigenen Grenzen, und das eigene Land auszubauen.“
…swoju stranu.“
Erzähler:
Auch die alte Einheit von Kirche, Staat und Gemeinschaft ist nicht wieder herstellbar, zumal das orthodoxe Christentum heute mehr noch als vor 1917 nur eine unter mehreren Religionen ist, die um die russischen Menschen werben. Islam, Buddhismus und in großen Teilen des Landes naturreligiöse Vorstellungen nicht-slawischer Völker sind ebenso Teil der russischen Identität. Auch die sowjetische Moral der nicht-kirchlichen, sozialistischen Ethik ist nach siebzig Jahren tief in der Bevölkerung verankert. Für die Wiederbegegnung mit der Religiosität bedeutet das:
O-Ton 8: Igor Tschubajs 2.10.01
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Wtaraja sostablajeschi…
„Zum zweiten Grundwert, der Orthodoxie: Wie soll es mit der Orthodoxie laufen? Natürlich ist die Frage der Religion eine sehr persönliche Frage. Unmöglich zu sagen, ihr müsst alle prawoslawisch, also orthodox christlich werden. Das geht nicht. Aber was ist die Orthodoxie, wenn wir sie nicht aus der Sicht der Religion, des Glaubens, des Atheismus betrachten, sondern aus dem der Kultur, der Kultorologie? – Die Orthodoxie ist ein System der Werte! Für den Buddhisten ist das Wichtigste die Einheit mit der Natur, die Erkenntnis seiner selbst als Teil der Welt. Für den Protestanten ist das Wichtigste die Aktivität, die Tätigkeit, die Arbeit, die Mühe, die Arbeitsmoral usw. Für den orthodoxen Christen ist das Wichtigste die Moral, das Wichtigste ist das sittliche Verhalten. Es heißt, in Russland habe es keine entwickelten Gesetze gegeben – hat es sehr wohl. Die Sowjetunion war ein nicht rechtsstaatlicher Staat; im historischen Russland dagegen gab es Rechte, gab es Gesetze. Die Rechte spielten bei uns allerdings niemals die Rolle, die sie zum Beispiel in Deutschland heute spielen oder in Amerika. Nicht deswegen, weil wir nicht entwickelt waren, sondern deshalb weil bei uns sehr viele Fragen über die Sittlichkeit gelöst wurden: Die Leute sprachen einfach miteinander, trafen Abmachungen und fertig. Wenn wir also wollen, dass Verbindungen zu unseren eigenen Traditionen wieder hergestellt werden, der eigenen Kultur, dann ist der Punkt nicht, dass alle gläubig sein müssen, der Punkt ist, dass das Wichtigste bei uns die höhere Geistigkeit ist, die Spiritualität, die Sittlichkeit: Geld ist sehr wichtig, aber es steht nicht an erster Stelle. Das Wichtigste ist, ein anständiger Mensch zu sein. Davon spricht die ganze russische Literatur, die ganze russische Folklore, die ganze russische Kultur. Wenn wir heute unsere Macht sehen, die korrumpiert ist, dann ist das nicht russisch, für Russland geht es nicht an, sich derartig aufzuführen. Das ist nicht akzeptabel für Russland.“
…nelsja sebja westi.“
Erzähler:
Für die dritte Säule, die Gemeinschaftstradition, russisch: Obschtschinost, lassen wir einen der vielen Intellektuellen sprechen, auf die Igor Tschubajs sich bezieht, wenn er von der entstehenden „Schule der Priemstwo“ spricht, die sich von unten entwickelt.
Boris Kagarlitzki – als scharfzüngiger radikaldemokratischer Analytiker der Perestroika-Generation einer romantischen Verklärung der alten Geschichte nicht verdächtig, erklärt zu Russlands Entwicklungschancen in der aktuellen Krise:
O-Ton 9: Boris Kagarlitzki, Analytiker 1.38.01
Regie: Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Sdjes mi widim…
„Hier sehen wir natürlich einige Elemente der Obschtschtina-Tradition, die – wie paradox auch immer – gerade heute in Russland anwächst. Sie wird transformiert. Die Obschtschina-Tradition fährt fort sich zu entwickeln, sie passt sich dem Markt an, sie bildet ihre eigenen, quasi-marktwirtschaftlichen Beziehungen heraus usw. Die Privatisierung hat die russische Wirtschaft in einen Zustand zwischen früherem Dirigismus und privatkapitalistischen Produktionsformen gebracht. Um sich zu entwickeln, brauchen wir neue Formen der Beteiligung und darin kann die russische Obschtschina Tradition ganz sicherlich eine positive Rolle spielen. Nicht im Sinne Szuganows, also Obschtschina als autoritäre Struktur, sondern anders. Die Obschtschina ist im Wesen ja doppelwertig; in ihr liegt ein autoritäres Potential und ein demokratisches. Das Paradoxon der russischen Obschtschina liegt eben in diesem Doppelcharakter und diese Doppelwertigkeit hängt vom sozialen Kontext ab, in dem die Obschtschina sich befindet. Warum war die Obschtschina früher autoritär? Weil sie in einem autoritären Staatsystem aufbaut worden war. Wenn wir diese Obschtschina in einem demokratischen Umfeld und unter anderen sozialen Prioritäten aufbauen, dann kann sie ihr demokratisches Potential entwickeln. Dafür muss man sich aber von den politischen Illusionen des Szuganowschen Typs lösen.“
..schuganowskawa Typa.“
Erzähler:
`Sich von den politischen Illusionen Szuganowschen Typs lösen´, das bedeutet, sich von den Illusionen eines volkstümelnden, hurra-patriotischen Kommunismus zu lösen. Nur dann, darin stimmt Boris Kagarlitzki mit Igor Tschubajs überein, können Tradition und Moderne sich miteinander zu neuen sozialen Impulsen verbinden.
Athmo 3: Verblenden, Musik kurz stehen lassen, 1.12.10
unter Erzähler allmählich abblenden
Erzähler:
Hart grenzt Igor Tschubajs sich auch von Intellektuellen des rechten Lagers ab, die dasselbe Vokabular benutzen wie er, die wie er von Akzeptanz, Kontinuität und Aktualisierung traditioneller Werte sprechen, damit aber die Rückkehr zur Expansionspolitik des Imperiums verbinden. Einer dieser Leute ist Alexander Dugin, Gründer einer aus der Umgebung des Präsidenten Putin finanzierten euro-asiatischen Bewegung. Er möchte Russland als euroasiatische Führungsmacht in einem globalen Kampf gegen die USA etablieren. Dugin, zu Hochzeiten der Persteroika als nationalistischer Radikaler marginalisiert, war im Jahr 2001Initiator von Konferenzen zum Islam, zur Rolle der Kirche und weiterer Themen, die vom Präsidenten-Apparat, von der Duma und der Kirche unterstützt wurden; seine Schriften in Zeitschriften und Büchern über die notwendige globale Konfrontation zwischen Russland und den USA liegen unter den Kopfkissen der wichtigsten Führungsfiguren des staatlichen, insbesondere geheimdienstlichen und militärischen Apparates.
Zu Alexander Dugins Aktivitäten befragt, antwortet Igor Tschubajs:
O-Ton 9: Igor Tschubajs 1.15.00
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Ja dumaju…
„Ich denke, dass die Idee der ´Priemstwo´, die Idee der Verbindung mit dem historischen Russland, eine Idee ist, die nicht ausgedacht, nicht künstlich ist; sie liegt in der Luft, sie kommt vielen in den Kopf, deshalb ist sie nicht nur mir in den Kopf gekommen, sondern auch Dugin, und einer Reihe weiterer Leute. Darin sehe ich etwas Positives; es zeigt: Wenn diese Idee etwas sehr Subjektives wäre, würde ich kaum jemand finden, der ihr zustimmte. Er ist dahin gekommen, ich bin dahin gekommen, andere sind dahin gekommen, das heißt, in dieser Vorstellung liegt etwas Rationales. Wenn aber Dugin und seine Parteigänger von „ Priemstwo“ sprechen, so wollen sie, so weit ich das verstehe, in vielem das alte Russland wieder herstellen, das damals existierte. Aber das zu bewirken ist nicht möglich und nicht nötig. Denn Russland war ein Imperium, Russland war mit Eroberungen befasst, Russland betrieb eine expansive Politik bei gleichzeitiger Vereinheitlichung, das ist heute absolut unnötig und unmöglich.“
…absolutna nje nuschna.“
Erzähler:
Und drastisch setzt Igor Tschubajs noch einmal nach:
O-Ton 10: Igor Tschubajs 0.40.00
Regie: O-Ton kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Tak, wot, setschas…
„Also, sich jetzt mit der Expansion zu befassen, im 21. Jahrhundert! Das war im 19. Jahrhundert gut – im 21. Jahrhundert ist das sinnlos. Das ist, wie einen Zwanzigjährigen zu säugen. Das ist ein Irrenhaus. Das geht nicht. Das ist eine Krankheit. Wir leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Situation, in einer anderen Kultur unter anderen Regeln; sich heute mit der Expansion zu befassen, ist eine Katastrophe.“
…eta katastrofa.“
Erzähler:
Erfolge auf dem Wege der Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses für sein Land erwartet Igor Tschubajs nur, wenn alle Kräfte auf den inneren Ausbau konzentriert werden. Hoffnungen dafür gibt es. Im Sommer 2001 hat ihn das Ministerium für Bildung beauftragt, Lehrbücher für die Ausbildung an russischen Lehranstalten nach den von ihm entwickelten Vorstellungen zu erarbeiten. Entsprechende Kommissionen für die Bereiche Geschichte, Sprache, Literatur und Philosophie sind bereits unter Leitung von Igor Tschubajs tätig.
Athmo 4: O.Ton allmählich kommen lassen, 0.37.00
nach Erzähler hochziehen, ausblenden
Erzähler:
Was davon verwirklicht wird, hängt allerdings nicht alleine von Igor Tschubajs und dem Stab ab, den er um sich versammeln kann, sondern von den, wie Igor Tschubajs es ausdrückt, Unwägbarkeiten der Macht und der allgegenwärtigen Bürokratie. Russland ist nämlich, das wird hier deutlich, nicht nur in vier nebeneinander liegende Zeitepochen gespalten, wie Igor Tschubajs es beschrieb, also alte, das sowjetische, das demokratische und das aus allem zusammengemischte Russland. Neben der zeitlichen Spaltung des Landes existiert vielmehr noch eine weitere, die vielleicht noch tiefer geht: Es ist die zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen Bürokratie und lebendigen Menschen. Diese Spaltung aufzuheben dürfte die größte Aufgabe sein, welche die „Schule der Priemstwo“ zu bewältigen hat, um Russland auf denem Weg zu sich selbst zu führen.
Regie: Musik hochziehen, ausklingen lassen
Tschetschenen – nur noch Banditen?
Besetzung:
Sprecher, Übersetzer, Zitatorin
Aussprache: Alle russischen Namen und Begriffe sind in phonetischer Umschreibung mit Betonungsangabe wiedergeben.
Anmerkung zu den O-Tönen:
Die Länge der O-Töne ist exakt angegeben. Zähleinheit ist 4,5 sec. pro Zeile plus 4,5 Sec. für die Auf- und 4,5 Sec. für die Ausblendung. Die Töne sind so geschnitten, dass Anfang und – wenn am Schluss aufgeblendet werden soll, dann auch – das Ende in der Regel für jeweils mindestens 4,5 Sec. den (fett) angegebenen Textanfängen oder Textenden entsprechen. Evtl. Schnittstellen ( in denen Übersetzung und Ton nicht mehr wortidentisch sind) liegen in der Mitte der Töne. Abweichungen von diesem Schema sind besonders angegeben.
2 Athmos, 15 O-Töne – alle hintereinander auf dem Band
Bitte die Schlüsse der O-Töne weich abblenden
Freundliche Grüße
Kai Ehlers
Länge: 26.700 Zeichen
Tschetschenen
– nur noch Banditen?
Athmo 1: Erkennungsmelodie TV 035
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, auslaufen lassen
Sprecherin:
Moskau, 9.1.2002, Tagesnachrichten: Es gebe keine Rebelleneinheiten mehr, sondern nur noch versprengte Banden, teilte der Generalstabschef der russischen Armee in Tschetschenien, Anatolij Kwaschnin der Öffentlichkeit mit. Neue Verhandlungen mit tschetschenischen Politikern, wie etwa die Gespräche zwischen Vertretern der russischen Regierung und Aslan Maschadows Leuten Ende des letzten Jahres, werde es nicht geben.
Athmo 2 : Erkennungsmelodie, Ausklang 0,19
Ton unter der Sprecherin langsam kommen lassen. Nach Sprecherin vorübergehend hochziehen, abblenden
Sprecherin:
„Es werden keine Fehler mehr gemacht“, erklärte Kwaschnin. Ruhe in Tschetschenien werde dann einkehren, wenn die Finanzierung der Banditen durch das Ausland aufhöre.“
Erzähler:
Meldungen solcher Art sind das Einzige, was der Kreml heute der Öffentlichkeit über Tschetschenien in den von ihm inzwischen gänzlich kontrollierten Medien mitteilt. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Woche für Woche gibt es kleinere Meldungen in der Presse oder auch noch im unabhängigen Sender „Radio Moskau“ über Anschläge auf russische Militäreinrichtungen in den besetzen Gebieten, über Attentate auf Vertreter der mit Moskau kooperierenden tschetschenischen Verwaltungsorgane, über Schießereien im südlichen Rückzugsgebiet der tschetschenischen Kämpfer, die Tote und Verletzte kosten. Genaue Zahlen werden selten bekannt. Der letzte dieser Vorfälle war der „Absturz“ eines russischen Armeehubschraubers über tschetschenischem Gebiet Ende Januar, dem zwölf Personen, unter anderen der stellvertretende russische Innenminister zum Opfer fielen.
Auf der anderen Seite reißen die Meldungen über so genannte Säuberungen der russischen Besatzungsmacht nicht ab. Im Widerspruch zu den offiziellen Darstellungen wies die Menschenrechts-Organisation „Memorial“ im Januar daraufhin, dass bei solchen Einsätzen der russischen Armee seit Ende Dezember 2001 in Argun und weiteren Orten Tschetscheniens erneut viele Zivilisten verschleppt, gefoltert und getötet worden seien.
Frau Cheda Saratowa, die für „Memorial“ und die „Stiftung zum Schutz für Glasnost“ vor Ort recherchierte, beschrieb ihre Eindrücke mit den Worten:
Sprecherin: Frau Cheda Saratowa
„Im Dorf Zozin-Jurt wussten die Leute zunächst nicht, wie viele Tote es gegeben hatte, wie viele mit unbekanntem Ziel verschleppt worden sind. Die meist betrunkenen russischen Soldaten verbrannten am Rande des Dorfes eine unbekannte Zahl von Leichen. Der ganze Ort stank nach verbranntem Fleisch und Verwesung.“
Erzähler:
Über hundert Todesopfer sollen allein bei diesem Einsatz gezählt worden sein. Frau Saratowa berichtete auch über die Ermordung des 37-jährigen Mussa Ismailow. Er war der Mulla von Zozin-Jurt. Seine Ehefrau Malika war Augenzeugin, wie die Soldaten ihren Mann fortschleppten: Ein Ohr war abgeschnitten. Das herabströmende Blut verklebte ihm die Augen. Als sie versuchte, den Soldaten zu folgen, drohten die, sie zu erschießen. Später durfte sie die Leiche ihres Mannes abholen, dies aber erst nachdem sie 1000 Rubel, umgerechnet 33 Dollar bezahlt und ein Papier unterschrieben hatte, in dem sie bestätigte, dass der tote Mussa Ismailow ein tschetschenischer „Bojewik“, also Kämpfer gewesen sei. Jungen Männern, berichtet sie weiter, wurden die Geschlechtsorgane abgeschnitten, einem 72-jährigen wurde mit dem Messer `Prosit Neujahr´ in die Haut geritzt.
Sprecherin: Frau Cheda Saratowa
„Vielfach lassen die betrunkenen Soldaten sich dafür bezahlen, dieses oder jenes Haus nicht zu `säubern´. Für 5000 bis 7000 Rubel sind sie bereit, auf die Durchsuchung zu verzichten. Jetzt hat die 36-jährige Witwe des getöteten Mullah Angst um ihren 17-jährigen Sohn. Sie fürchtet, dass er ebenfalls zur Waffe greifen wird, um seinen Vater zu rächen. Die meisten, sagt sie, die heute gegen die föderalen Truppen kämpfen und die als Banditen bezeichnet werden, sind einfache Leute, die ihre Verwandten rächen wollten, weil sie gegen alles Recht abgeschlachtet werden.“
Erzähler:
Berichte über Vorgänge dieser Art, die noch vor Jahresfrist Schlagzeilen in den kritischen Medien des Westens machten, finden sich heute nur noch dort, wo man auch unter der von den USA und dem Westen geschmiedeten „Allianz gegen den Terror“ dem Frieden mit Russland nicht traut, etwa bei der Zeitung „Die Welt“.
„Seit Russland als nützlicher Verbündeter der USA im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gilt“, so zitiert „Die Welt“ den Moskauer Politologen Andrej Piontowski, Direktor des unabhängigen Instituts für Strategische Studien, sei der Westen blind geworden für das, was in Tschetschenien geschehe. Den Moskauer Militärexperten Felgenhauer zitiert die Zeitung mit den Worten, die jetzige Haltung des Westens komme einer „totalen carte blanche“ für Moskau gleich.
Unmissverständlich reagieren die nicht-russischen Völker Russlands: Da sind zunächst ganz unverdächtige Zeugen – die Tschuwaschen. Mit ca. vier Millionen Menschen sind sie heute die zweitgrößte Minderheit in der russischen Föderation nach den Tataren; sie leben in einer autonomen Republik Tschuwaschien an der mittleren Wolga, mitten im Herzen Russlands also; sie sind brav und seit Jahrhunderten ins russische Imperium integriert, sie denken nicht daran, die Föderation zu verlassen; zudem sind sie seit vielen Jahrhunderten christianisiert. Nichtsdestoweniger verstehen die Tschuwaschen den Krieg Moskaus gegen die Tschetschenen als Angriff auf ihre eigene Autonomie:
O-Ton 1: Michael Juchma, 0,48
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
„Ja tschitaju, schto…
„Ich denke, dass der Krieg in Tschetschenien eine Tragödie ist, und zwar nicht nur für Tschetschenien, nicht nur für das russische Volk, sondern für ganz Russland, für alle Völker Russlands. Uns nicht-russische Völker schreckt das sehr auf. Heute erklärt Russland die Tschetschenen zu Feinden; einerseits soll Tschetschenien zu Russland gehören, andererseits wird das ganze Territorium bombardiert, wird alles vernichtet, wird das Land als Feind behandelt. Und was, wenn morgen die Tataren in die gleiche Lage kommen? Danach die Tschuwaschen? Dann vielleicht die Burjäten in Sibirien? Nach der Logik der Dinge ist das sehr wohl möglich.“
…polni wasmoschno.“
Erzähler:
Der so spricht, ist Michael Juchma, auch in Moskau hoch angesehener tschuwaschischer Volksschriftsteller, Gesprächspartner von Michail Gorbatschow, der seine Lebensaufgabe darin sieht, Geschichte, Mythen und Legenden der Wolgavölker zusammenzutragen, um sie dem Vergessen zu entreißen. Darüber hinaus leitet er das zu Michael Gorbatschows Zeiten entstandene tschuwaschische Kulturzentrum, das sich um eine Renaissance der tschuwaschischen Kultur bemüht.
Gleich neben der tschuwaschischen Republik liegt El Mari, ebenfalls eine autonome Republik, benannt nach den finnisch-ugrischen Stämmen, die hier nach der Völkerwanderung einst ein Zuhause gefunden haben. Auch die Mari sind keine Moslems, auch sie sind weit entfernt davon, sich aus der russischen Föderation lösen zu wollen. Doch auch die Mari fühlen sich durch eine Politik der inneren Kolonisierung bedrückt, die Moskau gegenüber seinen ethnischen Minderheiten inzwischen wieder eingeschlagen habe.
Der Krieg gegen die Tschetschenen, so kann man es im Kulturzentrum und beim Schriftstellerverband in Joschkar-Olar, der Hauptstadt der Republik El Mari, hören, sei nur der krasseste Ausdruck davon. Chenofan Chainikow, ein über die Grenzen El Maris und auch Russlands hinaus bekannter einheimischer Stalinismusexperte und Terrorismusforscher, nennt den Krieg einen Genozid, der von Historikern einst nicht anders beurteilt werden werde als die Verbrechen Stalins. Allen nicht-russischen Völkern sei klar, womit dieser Krieg sie bedrohe:
O-Ton 2: Joschkar- Olar, Chedofan Chainikow 0,28
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
„Oni sche ponimajut…
„Sie verstehen doch, was geschähe, wenn sie mehr Freiheit fordern würden. So die Inguschen, die Osseten, die Dagestani. Die Wolgavölker. Hundertfünfzig Millionen gegen eine Million! Das verstehen doch alle: Das ist das Gesetz des Dschungels wie es früher war! Die Wahrheit ist auf der Seiten dessen, der die Macht hat.“
… u kawo sila.“
Erzähler:
Unüberhörbar schließlich wird im benachbarten Tatarstan, der Heimat der größten kulturellen und ethnischen Minderheit des heutigen Russland, was die nicht-russischen Völker Russlands von den offiziellen Darstellungen des Tschetschenien-Konfliktes halten: Hier wird nicht nur die neokoloniale Politik Moskaus gegenüber seinen Minderheiten beklagt, hier – in dieser mehrheitlich muslimisch geprägten Republik – fühlt man sich auch als Moslem diskriminiert.
Ildu Sadikow, der Vorsitzende des tatarischen Zentrums in Kasan, kritisiert den tschetschenischen Separatismus; er ist stolz darauf, dass die Tataren für ihre – wie es in Russland heißt – nationalen Interessen, den Weg des Ausgleichs mit Russland gesucht haben. Unmissverständlich aber formuliert auch er:
O-Ton 3: Tatarisches Zentrum, Ildu Sadikow 0,33
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
„Wot, we etom wapros…
„In dieser Frage liegt natürlich viel Strittiges, aber ich denke, es hat eine Verletzung von moralischen und internationalen Normen durch die staatlichen Organe, und zwar von Seiten des herrschenden Volkes gegeben. Was jetzt dort stattfindet, ist ein Kolonialkrieg, mit dem Russland gewaltsam ein Volk halten will, das nicht bleiben will. Dieser Krieg findet schon hunderte von Jahren statt. Das tschetschenische Volk wurde ja auch deportiert, wie Sie wissen.“
…kak wy snaetje.“
Erzähler:
Als Tatare ist man solidarisch mit den um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Tschetschenen, als Moslem sieht man sich auf einer Seite mit den Glaubensbrüdern, die dort in Tschetschenien – gesegnet von den Patriarchen der orthodox-christlichen Kirche – verfolgt werden. Sogar im Islamischen Zentrum Kasans, der größten offiziellen Vertretung der Moslems in Russland, kann man Kritik an Wladimir Putins Kriegs-Kurs hören, obwohl die Leitung des Zentrums sich demonstrativ um Kooperation mit Moskau und der von Moskau zur Staatskirche erhobenen orthodoxen Kirche bemüht.
Wladimir Putin habe aus seinen Absichten ja gar kein Geheimnis gemacht, erklärt Waljulla Jaghub im Büro des obersten Mufti von Kasan und erinnert daran, was die Presse über Wladimir Putin berichtetete, noch bevor dieser zum Präsidenten gewählt war:
O-Ton 4: Mufti 0,22
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden
Übersetzer:
„Uwaschajemie gasjeti, pissali… n
„Die verehrte Moskauer Presse hat doch ganz offen darüber geschrieben, was Putin damals auf einer Versammlung des KGB erklärt hat: ´Wenn wir die Tschetschenen erledigt haben´, sagte er, `dann nehmen wir uns die Kane vor.´ Mit `Kanen´ meint er wohl uns.“
… nawerna my.“
Erzähler:
Ja, Kane, damit sind die Muslime Russlands gemeint, an der Wolga, im Kaukasus, in Sibirien, selbstverständlich auch in Moskau. Waljulla Jaghub lacht: er sei Realist, sagt er. Seine Behörden versuchen sich zu arrangieren. Draußen im Lande jedoch, nicht nur in Tatarstan, auch im benachbarten Baschkortastan und weiteren islamischen Republiken an der Wolga, ganz zu schweigen vom Kaukasus, hat sich unter solchen Bedingungen eine radikalere Stimmung herausgebildet, vor allem unter arbeitslosen Jugendlichen. Aus ihr gehen Freiwillige für den Einsatz in Tschetschenien hervor. Soziale Perspektivlosigkeit, Auflehnung gegen Diskriminierung, fehlgeleitete neue Religiosität und Hoffnung auf Abenteuer sowie leichtes Geld verbinden sich bei ihnen in der Bereitschaft zum Djihad, dem heiligen Krieg: Lieber Sterben als in Elend und Langeweile verkommen, lautet ihr Motto.
Scheich Adin, eben über Zwanzig, selbst arbeitslos, ist einer dieser jungen Männer. Als Chef des „Islamischen Zentrums“ in der von der russischen Krise existenziell betroffenen Industriestadt Nabereschnye Tschelni hilft er Freiwilligen dabei, an die tschetschenische Front zu kommen:
O-Ton 5: Scheich Adin 0,45
Regie: O-Ton langsam kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Übersetzer hochziehen
Übersetzer:
„I nje tolka…
„Und nicht nur für humanitäre Hilfe“, betont er. „Unsere jungen Leute kämpfen dort vor allem.“ Jeder entscheide natürlich für sich selbst. Wer dort sterbe, erlange große Ehre, er erhalte sogar ein besonderes Begräbnis. Er stehe höher als andere Muslime. Ja, das islamische Zentrum unterstütze diese jungen Leute: „Selbstverständlich“, so Schaich Adin, „denn sie erfüllen den Willen Allahs.“
…ispolnjajut wole Allacha.“
Erzähler:
Weitere Stimmen ließen sich aufzählen – selbst aus dem fernen Sibirien, wo Burjäten, wo Chakasen, wo Tuwiner, Jakuten und andere sogenannte kleinere Völker, obwohl keine Muslime, den Krieg gegen die Tschetschenen ebenfalls als Krieg gegen ihre eigene Souveränität und die Rechte von Minderheiten in Russland erleben.
Tschetschenien ist, so sehen sie es, lediglich der aktuelle Brennpunkt dieser Entwicklung. Moskau halte die Tschetschenen offenbar für besonders geeignet, um im Krieg gegen sie die Einheit des Imperiums wieder zusammen zu schmieden. Nicht selten wird die Rolle, welche die Tschetschenen dabei in Russland einnehmen, mit jener der Juden verglichen. Auch viele Tschetschenen sehen sich in diesem Vergleich.
Mussa Tumssojew *, selbst Tschetschene, ist einer von denen, die die tschetschenische Tragödie in dieser Weise verstehen. Er ist leitender Mitarbeiter an der russischen Akademie der Wissenschaften* in Moskau. Wo er an Problemen der regionalen Entwicklung forscht.
Ja, diese Vergleiche mit den Juden gibt es, sagt er:
O-Ton 6: Mussa Tumssojew 0,45
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
“Schtoby tebja sametili…:
„Es hieß, um bemerkt zu werden, muss man entweder Jude oder Tschetschene sein. Die Tschetschenen selber sagen es so: Es gibt generell zwei Perioden, eine, in der man sich mit den Juden beschäftigt und eine, in der man sich mit den Tschetschenen befasst. Wenn man sich nicht mit den Juden befasst, dann quält man die Tschetschenen; jeder wird auf diese Weise traktiert. Wenn es um Extreme, um Krisen geht, dann werden eben Freimaurer oder Juden gejagt. Geht es gegen die Tschetschenen, dann können die Juden sich ein bisschen erholen – und umgekehrt. Es heißt: Wenn es gut wird für die Tschetschenen, dann ist es nicht gut für die Juden.“
… ne charascho jewreom.“
Erzähler:
Wie die Juden, so Mussa Tomssojew, leben die Tschetschenen seit Jahrhunderten in der Diaspora: Aus dem Westen – nicht aus dem Osten, auch nicht aus dem Orient, betont Mussa Tumssojew, sondern aus Europa – in den Kaukasus eingewandert, hätten sie sich dort nicht integrieren können. Von den anderen Völkern des Kaukasus unterschieden sie sich durch ihre helle Haut und durch ihre Sprache, von den Russen durch ihre archaischen Traditionen. In der Ungepasstheit, die ständig das Problem des Überlebens aufwerfe, so Mussa Tumssojew, liege daher ihr besonderer Charakter:
O-Ton 7: Mussa Tomssojew
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Wyschewannije…
„Das Phänomen des Überlebens hat zu besonderen Traditionen geführt, welche die Tschetschenen seit Jahrhunderten bewahrt haben. Anders kann ich mir auch heute kein Überleben vorstellen, wenn es keine Arbeit gibt, keine Pensionen gezahlt werden, überhaupt nichts gezahlt wird, obwohl die Familien dutzende Köpfe haben. Wovon leben sie? Sie leben auf Kosten derer, die zureisen, die sie ernähren, von den Übrigen draußen, die alles geben, was sie haben. Das ist normal – für uns ist das irgendwie normal. Für andere mag es wichtig sein, sich selbst einzurichten; für uns ist es wichtig, sich mit der Familie einzurichten. Solche Umstände! Können Sie sich eine Einzimmer-Unterkunft vorstellen, während des Krieges und darin fünfzehn Menschen? Auch das ist für uns normal. Bei mir war es auch so. Als ich hier auf meine Wohnung siebzehn Menschen anmeldete, hörte ich bei der Polizei: `Was denn, wie geht das?! Das ist doch physisch unmöglich!´ Ich habe sie gefragt: `Und fünfzehn Leute im Zelt in Inguschien – das ist möglich?´ – Hauptsache sie überleben; das sind meine Probleme.“.
…eto moi problemi.“
Erzähler:
Kern der Traditionen, die sich so herausgebildet haben, ist die Familie. Sie ist die Stütze des Überlebens – und in der Familie, so Mussa Tumssojew weiter, ist es deren patriarchale Struktur:
O-Ton 8: Mussa Tomssojew 0,50
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Bei uns gilt vor allem das Prinzip des Ältesten. Seine Verwandten sind ihm, sagen wir, direkt untergeordnet. Er kann Vater, Großvater oder Urgroßvater sein. Er hat praktisch für jede Entscheidung das Wort der höchsten Autorität. Wenn es um Hilfe geht, dann haben Tanten, Onkel und generell Verwandte auch mitzusprechen. Ich denke, dass die Tschetschenen in den letzten zehn Jahren des Krieges nicht verhungert sind, verdanken sie vor allem diesen familiären Beziehungen. Und in diesem Sinne nicht nur Vater, Mutter, Bruder, Schwester, sondern auch die Onkel und die Onkel zweiten Grades und die weite entfernten Verwandten und alle die ihr Schärflein zur materiellen Existenz beigetragen haben.“
… materialni sosstajannije.“
Erzähler:
Der Zusammenhalt dieser Familie ist nicht an einen Ort gebunden. Entscheidend ist, wo sich der Älteste befindet: Solange er lebt, lebt die Familie. Der Zusammenhang der Familie ist unter allen Umständen zu wahren und zu verteidigen. Aus der Sicht eines jungen Mannes, der als Vorstand einer tschetschenischen Flüchtlingsgruppe in Tatarstan lebt, sind schon die Tschetschenen, die sich in die Moskauer Duma haben wählen lassen, keine Tschetschenen mehr. Sie sind für ihn Abtrünnige, Verräter:
O-Ton 9: Vorstand von Nabereschnye Tschelni 0,50
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Tschetschenen – die töten, wenn ein Feind kommt, mit der Waffe in der Hand ihre Kinder, Vater, Sohn, Mutter. Niemals werden sie mit dem Feind zusammenarbeiten. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben bis heute die Blutrache. Bringt man meinen Bruder um, muss ich die Schuldigen töten. – Dieser Krieg werde niemals aufhören, meinen Leute vom Typ Schirinowskis – recht hat er: Man muss schon alle Tschetschenen vernichten, bevor es Ruhe in Russland gibt. Solange der letzte Tschetschene noch nicht getötet ist, wird der Krieg nicht enden. Wenn sie nicht nur Dudajew, Chattab, Bassajew und andere, vielleicht ein Dutzend Leute der Führung umbringen, sondern das ganze Land niedermachen, wenn sie Dörfer, Bezirkszentren, Städte, tausende und abertausende Frauen, Kinder und Alte vernichten, wie kann es da Freundschaft mit Russland geben? Nicht einmal reden kann man darüber!“
… bytj ne moschet.“
Erzähler:
Da ist sie, die andere Seite der Archaik, wie sie auch von einem Europäer oder europäischen Russen nicht schärfer gezeichnet werden könnte. Mussa Tumssojew, mit dieser Aussage konfrontiert, bestätigt, dass diese Sitten im Allgemeinen bis heute gültig seien. Nicht alle seien damit ganz glücklich, auch er selbst nicht; das Bild vom „wilden Tschetschenen“ aber weist er, höflich doch deutlich, zurück:
O-Ton 10: Mussa Tumssojew 0.45
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Pri swem wot eta…
„Bei aller Wildheit, die man uns zuschreibt, ist es doch so: Angesichts des Nicht-Vorhandenseins von Staat, sowohl auf russischer als auch auf tschetschenischer Seite, nicht einmal gerechnet die dauernden Umsturzversuche, leben unsere Bürger heute unter Bedingungen, dass sie sich selbst schützen müssen. Unter diesen Umständen haben diese Einrichtungen, einschließlich jener der Blutrache, des Prinzips der Ältesten und andere doch eine wesentliche Funktion dafür, dass, sagen wir, das Verbrechen keinen massenhaften Charakter annimmt, denn mögliche Banden, die etwas Kriminelles planen, müssen gewärtig sein, dass daraus eventuelle ein Gegenschlag erfolgt.“
…atwjetni udar.“
Erzähler:
Nicht die angebliche Wildheit habe den Terrorismus hervorgebracht, fährt Mussa Tumssojew fort, und nicht der Terror den Krieg, sondern der Krieg den Terror und die angebliche Wildheit sei möglicherweise gerade das, was seinem Volk das Überleben ermögliche:
O-Ton 11: Mussa Tumssojew 1,40
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Ja schitaju schto…
Ich glaube, dass gerade diese Gebräuche und Traditionen positiven Charakter tragen; sie sind nicht negativ und sie sind keine Bremse für eine progressive Entwicklung der tschetschenischen Gesellschaft; in keiner Weise, absolut nicht. Traditionen, die man im Westen wilde nennt, würden dort, im Westen vielleicht die Entwicklung behindern, für uns stimmt das überhaupt nicht. – Was ich jetzt sage, mag für einen Europäer vielleicht ein bisschen beleidigend sein, aber unsere Wildheit führt jedenfalls nicht zu dieser Eingeschlechtlichkeit, nicht zu dieser, sagen wir, Progressivität, dieser Duldsamkeit, mit der die Europäer heute Homosexuelle und was weiß ich alles tolerieren – und bestenfalls darüber lächeln. Wir können darüber nicht lachen – das ist für uns Wildheit! Wie kann so etwas sein?! Also, wir sehen bei den Europäern unsererseits so viel Wildheit! Deshalb gefällt mir, deshalb gefällt uns allen unser Konservativismus und unsere Wildheit, die uns helfen, eine normale Familie zu haben, in der ein Mann ein Mann ist und eine Frau eine Frau, in der die Kinder sich den Eltern unterordnen, deshalb gefallen uns Eltern, die ihre Kinder in den Schlaf singen, alles aus ihnen machen und nicht solche, in der die Kinder die Eltern am Ende aufgeben. Warum verbringen die Tschetschenen auch als Erwachsene ihre Zeit mit den Eltern? Warum gibt es die verlassenen Häuser bei uns nicht? Warum gibt es bei uns kaum obdachlose Kinder? Warum? Wie soll man das einem Europäer erklären?!“
…kak objasnjat ewropezem?“
Erzähler:
Schwer, dies einem Europäer zu erklären, schon gar, wenn der Wert der Toleranz dabei in Frage gestellt wird. Mit „Europäer“ sind in diesem Falle auch die Russen gemeint, deren Beziehungen zwischen Vater und Sohn, zwischen Männern und Frauen Mussa Tumssojew als für sich unverständlich beschreibt.
So steht man sich in einer Weise fremd gegenüber, welche die russische Psychologin Irene Brezna in einem Aufsatz über die Agressionen zwischen vaterdominanter tschetschenischer und mutterdominanter russischer Gesellschaft zu der Feststellung führt, der russische Sohn, der russische Mann sei dazu verdammt, sich immer wieder mit Gewalt aus der übergroßen Abhängigkeit von der Mutter zu befreien, ein unterwürfiger Mutterkult bringe die Aggression gegen die Mutter, die Famile als andere Seite der Medaille krass hervor, während die tschetschenische Familie ihre Söhne, ihre Kinder von vornherein frei lasse und so den Wert der Familie erhalte. Schon in der Sprache zeige sich dieser Unterschied.
Frau Brezna scheut sich nicht sehr deutlich zu werden:
Zitatorin: Irena Brezna
„Das häufigste Schimpfwort, das wie ein Refrain die Sprache des russischen Sohnes über alle Schichten hinweg durchzieht, spricht für sich – job tvoju matj, fick deine Mutter. Bei jeder kleinsten Alltagsverärgerung wird die Mutter geschändet, was wohl Erleichterung verschaffen soll, eine Art Emanzipation des Sohnes heraufbeschwört. Grobes Fluchen heißt auf Russisch mat, meteritsa, materschtschina, es stammt von matj, die Mutter ab, an die es unzertrennlich gekoppelt ist. Im vaterdominanten Kaukasus ist mat dermaßen tabu, dass die russischen Soldaten, die in jedem Satz die Ausdrücke automatisch gebrauchen, wegen dieser schlimmsten Ehrenverletzung von den Tschetschenen umgebracht werden können. Die russisch-kaukasische Grenze ist auch diese sprachliche.“
Erzähler:
Und Frau Brezna ergänzt noch:
Zitatorin: Irene Brezna
„Es erscheint mir nicht abwegig, neben den geostrategischen Interessen auch den Neid als Faktor im Feldzug gegen den Nordkaukasus anzuführen – den Neid des im geistigen Inzest lebenden russischen Sohnes auf eine Kultur, die die Loslösung von der Mutter als Vorbedingung für die Menschwerdung fordert. Die räumliche und die geistige Distanz zwischen Menschen ist zwar bei den Tschetschenen vor allem vom Geschlecht bestimmt und ihre Form durch die Gebräuche streng vorgegeben, aber das Recht auf Abgrenzung ist grundlegend für ihren Begriff der menschlichen Würde und Existenz überhaupt.“
Erzähler:
Neid könnte auch in einer anderen Frage noch Triebfeder des Hasses sein, der sich zur Zeit in Tschetschenien austobt: Ähnlich wie bei den Juden haben sich auch aus der tschetschenischen Diaspora Umtriebigkeit und aktiver Händlergeist als besondere Fähigkeiten des tschetschenischen Volkes herausgebildet, die den Tschetschenen schon zur Sowjetzeit einen Sonderstatus eintrugen.
Mussa Tumssojew charakterisiert diesen Zug mit den Worten:
O-Ton 12: Mussa Tumssojew 1,35
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Tschitaetsja otschen…
„Für die Tschetschenen ist es eine Schande, wenn sie dir nichts auf den Tisch stellen können. Aber das muss man natürlich irgendwie verdienen. In der sowjetischen Zeit war Saisonarbeit in Tschetschenien daher sehr weit entwickelt: Man hatte seinen staatlichen Arbeitsplatz, im Urlaub oder an freien Tagen fuhr man nach Kasachstan oder nach Russland und arbeitete noch da oder dort. Vor allem im Sommer wenn der Bau im Gange ist. Kann man sich so ein Volk vorstellen? Angesichts dessen, was in letzter Zeit geschehen ist und dessen was man so spricht, scheint es paradox, aber die Tschetschenen sind ist ein außerordentlich arbeitsames Volk. Auch gerade weil sie in diesen Mängeln leben. Sie sind sehr mobil. Für sie sind Grenzen keine Hindernisse. Alles, was irgendwie materiellen Wohlstand bringen könnte, sind sie bereit zu realisieren. In der sowjetischen Zeit haben viele auf diese Weise gearbeitet. Das, was sich heute Kommerz nennt, das Kleine Business, das ist schon lange vorher, noch in der sowjetischen Zeit in Tschetschenien entwickelt gewesen, die Korporativ-Bewegung hat unter den Tschetschenen eine sehr starke Unterstützung gefunden. Als es dann entsprechende Gesetze gab, haben die Tschetschenen zweifellos versucht, ihr Kapital zu vergrößern.“
… naschit swoi kapital.“
Erzähler:
Ja, bestätigt Mussa Tumssojew dann, für diese Sonderrolle würden die Tschetschenen heute abgestraft. Der weit verbreiteten Verbitterung über die russische Krise werde durch ihre Verfolgung ein Ventil gegeben:
O-Ton 13: Mussa Tumssojew 0,30
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Nu obsche u nas….
„Generell heißt es bei uns, dass wir alle fünfzehn Jahre bestraft werden – fünfzehn Jahre Widerwärtigkeiten, dann fünfzehn Jahre Rückkehr zu uns selbst. Fünfzehn Jahre wird etwas hervorgebracht, aber kaum stehen wir wieder auf den eigenen Beinen, kaum besitzen wir wieder etwas, dann geht es wieder von vorne los.“
…konfliktnaja situatia.“
Erzähler:
Hiermit enden die Parallelen zwischen Tschetschenen und Juden allerdings. Anders als die Juden, so Mussa Tumssojew, haben die Tschetschenen keine geschriebene Geschichte, keine kulturelle Kontinuität, keine Stabilität einer politischen oder staatlichen Entwicklung. Seine Betrachtung dieser Unterschiede endet in dem Seufzer:
O-Ton 14: Mussa Tomssojew 0,50
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
„Dwe tisatschi ljet…
„Die Juden hatten zweitausend Jahre lang keinen Staat und hatten ihn doch. Sie überlebten intellektuell. Wir versuchen es leider durch Stärke. Wir glauben, dass wir stark sind, sogar stärker als die Starken, obwohl es nötig wäre, sich gerade davor zu fürchten. Die andere Seite der Stärke ist ja die Kurzfristigkeit ihrer Effekte, während intellektuelle Kraft auf Dauer wirkt. Aber es scheint, dass uns Tschetschenen diese kurzfristigen Heldentaten besser gefallen, die kurzfristigen Demonstrationen von Stärke, obwohl ich immer sage, wenn es uns gelingen soll zu siegen, einen Staat aufzubauen, dann nicht nur durch Stärke; Stärke, Kraft, Gewalt kann nicht das wichtigste Mittel zur Lösung unserer Fragen sein.“
… naschewa wapros.“
Erzähler:
In diesem Gedanken liegt für Mussa Tumssojew auch die Lösung der tschetschenischen Krise, selbst wenn er sich schwer tut, daran zu glauben:
O-Ton 15: Mussa Tomssojew 0,50
Regie: Ton kommen lassen, kurz stehen lassen, abblenden, unterlegen, hochziehen
Übersetzer:
Seufzer; „Tut…
„Da ist es sehr schwer, Rezepte zu geben. Es gibt ja sehr unterschiedliche Phasen des Konfliktes, der sich verändert, der sich verengt hat; es gibt die persönlichen Konstellationen: Dudajew/Jelzin, Maschadow/Putin, Bassajew und andere. Jede Seite führt den Kampf irgendwie mit eigenen Vorstellungen. Nur eins ist sicher: Auf tschetschenischer Seite wird immer wieder erklärt, dass es sich um einen Kampf für die Unabhängigkeit handelt; die andere Seite behauptet immer wieder, dass sie den Krieg für die Unversehrheit ganz Russlands führe. Das heißt, wir kommen dahin, ungeachtet einer reihe von Banditen und Terroristen auf beiden Seiten, dass es letztlich sehr wohl um den Status der Republik geht. Das kann man kaum in Frage stellen. Da man den letzten Krieg aber nun einmal unter der Losung des internationalen Terrorismus begonnen hat, kann man nicht damit enden, das ganze Volk umzubringen: Wenn die russische Seite die Unterstützung des Volkes haben will, um mit ihm zu siegen, dann muss sie erklären und zeigen, dass sie bereit ist, den Krieg auch tatsächlich ausschließlich gegen Banditen und Terroristen zu führen und dass die Frage der Unabhängigkeit für die Bevölkerung entschieden werde, wenn sie bereit sei, die russische Regierung im Kampf gegen die Terroristen zu unterstützen. Man muss das Recht der Tschetschenen auf Unabhängigkeit deklarieren, dann kann man den Teil des Volkes gewinnen, der auf dieser Seite steht. Diese Frage kann man über ein Referendum entscheiden.
…referendum.“
Erzähler:
Frieden werde es nur geben, wenn öffentlich erklärt werde, dass die Frage der Unabhängigkeit entschieden werde und wenn Verhandlungen geführt würden. Der jetzige Präsident Aslan Maschadow müsse nicht unbedingt auch der zukünftige sein, aber er sei nun einmal der gewählte, gesetzliche Präsident, mit dem jetzt verhandelt werden müsse. Alles andere könne dann schon Sache von Verhandlungen sein.
Dies ist die Stimme der Vernunft, aber ob sie gehört wird, hängt nicht allein von der Einsicht solcher Menschen wie Mussa Tumssojew ab, ebenso wenig allein vom Willen der Völker Russlands, sondern auch vom internationalen politischen Klima. Ein Ende des Mordens wird es erst gefunden werden können, wenn auch die internationale Gemeinschaft imstande ist, ein Volk wieder als Volk und nicht nur als Ansammlung von Banditen und den Kampf um Selbstbestimmung wieder als legitim statt als bloßen Terrorismus zu erkennen .
In Putins Russland kein Platz mehr für Rechte?
Besetzung:
Sprecher, Übersetzer, Übersetzerin
Aussprache: Alle russischen Namen und Begriffe sind in phonetischer Umschreibung mit Betonungsangabe wiedergeben.
Anmerkung zu den O-Tönen:
Die Länge der O-Töne ist exakt angegeben. Zähleinheit ist 4,5 sec. pro Zeile plus 4,5 Sec. für die Auf- und 4,5 Sec. für die Ausblendung. Die Töne sind so geschnitten, dass Anfang und – wenn am Schluss aufgeblendet werden soll, dann auch – das Ende in der Regel für jeweils mindestens 4,5 Sec. den (fett) angegebenen Textanfängen oder Textenden entsprechen. Evtl. Schnittstellen (in denen Übersetzung und Ton nicht mehr wortidentisch sind) liegen in der Mitte der Töne. Abweichungen von diesem Schema sind besonders angegeben.
18 O-Töne – in zwei Einheiten nacheineinander (A und B) zum Verblenden auf dem Band
Bitte die Schlüsse der O-Töne weich abblenden
Den O-Ton B 2 (kirchlicher Gesang) sollten Sie, bitte, einmal vorher durchhören, bevor Sie die Kommentare setzen. Danke.
Freundliche Grüße
Kai Ehlers
Länge: 29 977 Zeichen
In Putins Russland
kein Platz mehr für Rechte?
A 1 – O-Ton: Platz, Ansagen durchs Megafon 1.55.17
Regie: Athmo kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen, verblenden
Erzähler:
Moskau, Versammlung vor dem so genannten „Weißen Haus“. Hier hat Russlands jüngere Geschichte ihre Gedenkstätte. Der „Tag der Demokratie“ wird hier alljährlich begangen. Er gilt dem Gedenken an die Verhinderung des konservativen Putschversuches vom August 1991, die Boris Jelzin an die Macht brachte. Er gilt auch de Erinnerung an den Sündenfall der russischen Demokraten zwei Jahre später, als Boris Jelzin die Duma in eben demselben Haus zusammenschießen ließ. Mehrere provisorische Altäre, immer mit frischen Schleifen behängt, mahnen an die Opfer beider Ereignisse, die sich hier vermischen. Heute geht es um die zehnte Wiederkehr des demokratischen Aufbruchs. Aufgerufen hat die „Union rechter Kräfte“, die Vereinigung derer, sich immer noch Demokraten nennen, obwohl im Volksmund aus Demokraten längst „Dermokraten“ geworden sind.
Der Zulauf ist spärlich. Dreihundert, vielleicht vierhundert Menschen treffen sich auf dem weitläufigen Gelände. Einzelne, schon etwas vergilbte Porträts von Boris Jelzin tauchen auf, ebenso nicht mehr ganz frische Bilder der jungen Männer, die hier den Tod fanden. Die Erinnerungen sind längst zu Floskeln geronnen:
…Megafon
B 1 – O-Ton: Gruppe von Männern und Frauen 30.19
Regie: Verblenden, kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen, verblenden
Erzähler:
„A sewodnja…
Einen Feststag will dieser Mann begehen. „Die Revolution feiern“, fügt er hinzu. „Uns erholen“, meint die Frau, „damals hatten wir Angst, es war alles so schwer; jetzt ist es besser, besonders Putin, der Präsident. Das Volk hat sich beruhigt, ist normal geworden, er auch. Warum soll es für das Volk auch immer schlecht sein?“
… malawata potschemu ta.“
Erzähler:
Auch jüngere Leute haben sich eingefunden:
A 2 – O-Ton: Musik, Junge Leute vor dem „Weißen Haus“ 60.21
Regie: Verblenden, kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen, allmählich abblenden
Erzähler:
„A sdjes proischodit
„Eine Feier für die Erneuerung der russischen Flagge wird hier begangen“, antwortet ein Jugendlicher auf die Frage, warum er und seine Freunde hierher gekommen seien. „Erinnerung ist wichtig“, meint ein anderer. Die Schule kann noch keine Fakten bringen, dort wird die Liebe zu Russland gelehrt.“ Ganz einig ist man sich aber nicht: „Jelzin brachte Demokratie“, meint ein Mädchen. „Anfangs ja, jetzt schon nicht mehr“, widerspricht ein Junge. Aber jeder könne doch frei entscheiden hier zu sein, wirft ein weiterer ein. „Putin ist in Ordnung; er ist ein guter Mann.“ Das finden sie alle, auch wenn Macht, ergänzt einer, immer irgendwie schlecht sei.
…dastatitschna charoschi.“
Erzähler:
Auch ein paar jugendlicher Glatzköpfe sind erschienen. Sie geben zunächst dasselbe Motiv für ihre Anwesenheit an wie die Altersgenossen um sie herum, allerdings einen Ton aggressiver:
A 3 – O-Ton: Skins 19.32
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Erzähler:
Platzgeräusche, „Eta snaminatelnaja Data…
„Das ist ein wichtiges Datum unserer Geschichte: Da sind all diese überflüssigen Leute verschwunden, die Kommunisten usw. Jelzin kam an die Macht und mit ihm die Demokratie. Das ist ein Feststag für unser Land.“
..stranje iskatj.“
Erzähler:
Von Wladimir Putin allerdings halten sie nichts: Der sei doch halber Kommunist und führe keine anständigen, wie sie sagen, „nationalen“ Reformen durch. Gefragt, was sie unter „nationalen Reformen“ verstehen, antworten sie:
A 4 – O-Ton : Skins, Forts. 32,24
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Nu takowa tschelowjek…
„Nun einen solchen Menschen mit nationalistischen Ansichten gibt es zurzeit nicht, der unser Land von all diesen Nicht-Russen säubern würde, den Tschetschenen usw. Aber wir sind National; wir lesen viel Nationales. Bald werden die Skins hier an der Macht sein. Dann wird alles gesäubert, dann gibt es hier nur noch die weiße Welt.“
…tolka bjeli mir.“
A 5 – O-Ton: Skins Forts. 1.20.39
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, zwischen Übersetzer und Erzähler vorübergehend hochziehen, wieder unterlegen und am Schluss verblenden
Erzähler:
Zu dem Treffen der Demokraten kommen sie, “weil das hier“, sagen sie, „so oder so ihr Fest“ sei, ein Fest Russlands. In letzter Zeit seien sehr viele Skin-Gruppen in Moskau und in Russland entstanden, erzählen sie. Viele Zeitungen gebe es, viele Aktionen. „Zu Führers Geburtstag““, sagt einer. „gab´s eine Aktion gegen Nicht-Russen, die haben wir auf dem Markt platt gemacht. Bei uns läuft zurzeit alles ganz gut. Es gibt tausende von uns. In Moskau, außerhalb, egal, überall trifft man uns heute.“
Regie: Vorübergehend hochziehen
Erzähler:
„Heute begreifen viele, dass unser Land Patrioten braucht und sie werden zu Skins“, fährt der Glatzkopf fort. Sein Nebenmann ergänzt: „Wir kämpfen gegen diese ganzen Antifaschisten, Kommunisten, Nicht-Russen, auch gegen Skins, die es mit den Kommunisten halten.“ Wie? „Nun, mit dem den einfachsten Mittel“, grinsen sie und zeigen die Fäuste.
… borimsja.“
B 2 – O-Ton: Klerikale Gesangsgruppe 2.21.14
Regie: Verblenden mit O-Ton 6, unterlegen, allmählich kommen lassen, verschiedentlich zwischen den Kommentaren hochziehen, am Schluss verblenden
Erzähler:
Gesang….
Noch sind diese Worte nicht verklungen, da zieht eine Gruppe in farbigen klerikalen Gewändern auf den Platz. Sie wirbt zwar nicht mit den Fäusten, aber ebenso eindrücklich für Patriotismus:
Regie: Zwischendurch hochziehen:
Erzähler:
„Oh, heiliges Russland!“ „Oh, goldenes Russland!“ „Oh, rechtgläubiges Russland!“ ruft der Vorsänger. „Oh, heiliges Russland! Oh, rechtgläubiges Russland! Oh, gesegnetes Russland!“ wiederholt der Chor.
Regie: Zwischendurch hochziehen
Und auch im Folgenden immer wieder hochziehen
Erzähler:
Die Gespräche auf dem Platz ersterben. Die Menschen bestaunen den malerischen Auftritt und lauschen gebannt, wie ein Hochruf dem anderen folgt:
„Heil der Zarin des Reiches!“ ruft der Solist.
„Heil! Heil! Heil!“ antwortet der Chor.
„Heil der Wiedergeburt von Russlands Größe am Weißen Hause im August 91!“ – wieder: „Heil! Heil! Heil!“
Weitere Sprüche sind:
„Heil der Mutter unseres Herrn!“
„Heil der Mutter des neuen heiligen Russland!“
„Heil unserer ewigen Unbezwinglichkeit!“
„Heil der Mutter der neuen Menschheit!“
Regie: Zwischendurch hochziehen
Erzähler:
Der Gesang beschwört wieder und wieder:
„Oh, Russlands, das herrschende! Oh, russisches Reich!
….Gesang
Regie: Unter dem Erzähler verblenden
Erzähler:
Gut eine halbe Stunde dauert die Vorführung. Niemand schreitet ein. Im Gegenteil, der Platz füllt sich mit Neugierigen. Ein Mann mittleren Alters meint:
A 6 – O-Ton: Mann 50.36
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen, verblenden
Erzähler:
„Dlja menja…
„Für mich ist das neu. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Das findet ja sonst in der Kirche statt. Ich finde das angenehm. Ich sehe junge, ehrliche Menschen, die eine neue Spiritualität haben. Und sie haben viel Leute angezogen. Es scheint, als ob die Kirche sich jetzt auch wandelt: Man geht ins Volk, man bezeugt Gott so wie es sein soll. Das spricht sogar junge Leute an, die hier stehen geblieben sind. Die Kirche wird der neue Rahmen für Russland. Das ist sehr gut. Gebe Gott, dass sich das weiter entwickelt. Ich sympathisiere damit. Das ist sehr gut.“
…otschen charascho
Erzähler:
In einer Gruppe von Passantinnen erklärt eine Frau:
A 7 – O-Ton: Passantin 57.29
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, nach Erzähler wieder hochziehen, unter Erzähler allmählich abblenden, unterlegen
Übersetzerin:
„Na skolka ja ponila…
„Soweit ich verstehe ist das eine Sekte von Altgläubigen. Da ich nicht in die Kirche gehe, liegt mir das fern, aber die Kostüme haben mir gefallen.“
Erzähler:
Der Nationalismus der Gruppe stört sie nicht, ebenso wenig wie den Mann vor ihr. „Wieso? Russland ist nun mal ein Imperium!“, meint sie. Auch wenn es jetzt eine Demokratie sei und manche Schwäche habe, so bleibe es doch ein großes Reich. „Es ist ein riesiges Land“, erklärt die Frau, ,,und ein riesiges Potential, in dem kluge und nachdenkliche Menschen Leben.“ Es scheine wohl so, lacht sie dann, dass sie eine Patriotin sei.
…swoij strani.“
Erzähler:
Damit gibt sie die Stimmung wieder, die den Platz erfasst hat –Bekenntnisse zur Demokratie als patriotische Nostalgie! Die Veranstalter zeigen sich wenig beunruhigt. Die Gruppe sei nicht eingeladen worden, ist auf Nachfragen von einem der Organisatoren zu erfahren, öffentlich aber distanziert man sich nicht.
Nur einer aus der Reihe der vielen Redner und Rednerinnen findet kritische Worte. Es ist Jefgeni Proschtschetschin. Er ist ebenfalls Mitglied der „Union rechter Kräfte“, aber als Vorsitzender des „Moskauer Antifaschistischen Komitees“ und als Abgeordneter der Moskauer Stadt-Duma von 1995 bis 1999, wo er den Vorsitz über die „Kommission gegen Extremismus“ führte, steht er den patriotischen Tendenzen seiner eigenen Partei kritisch gegenüber. Der nostalgischen Stimmung angepasst, aber mahnend erklärt er daher:
A 8 – O-Ton: Jewgeni Proschtschetschin 2.00.05,
Chef des Moskauer antifaschistischen Zentrums
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Daragije drusja…
„Liebe Freunde! Russische Bürger, die ihr hierher gekommen seid! Wir alle sind glückliche Menschen, ungeachtet der Mühen unseres schwierigen Lebens. Wieso sind wir glücklich? Weil wir einen der dramatischsten Augenblicke der Geschichte erleben durften. Wir sahen das, was die unsere Nachkommen einst die große Augustrevolution nennen werden. Und wir haben sie mit eigenen Händen bewirkt. Aber ich möchte doch etwas anmerken: Einer meiner Vorredner schwärmte eben davon, wie gut es sei, dass die früheren Putschisten heute die Duma akzeptieren. Ich möchte doch aus Erfahrung sagen, dass wir heute noch nicht so weit sind, dass das ganze Volk, milde gesagt, einheitlich hinter einem neuen Russland, hinter der Demokratie stünde. Ja, zwar arbeiten frühere Putschisten heute in der Duma, zwar leitet Herr Lukianow zum Beispiel die Gesetzgebende Versammlung, aber die Duma hat es immer noch nicht geschafft, die ihr vorliegenden antifaschistische Gesetze zu beschließen. Das weiß ich genau, denn ich habe die Entwürfe ausgearbeitet. Wir sind noch weit von demokratischen Verhältnissen entfernt; das wird noch hundert Jahre dauern. Demokratie und Patriotismus sind nicht dasselbe! Da muss man nicht naiv sein! Allerdings, auch wenn wir jetzt wenige sind, ist das nichts Schlimmes: Ein Großer Fluss beginnt mit kleinen Rinnsalen und der steter Tropfen höhlt den Stein. Und wir werden uns hier immer wieder versammeln, damit Russland sich Schritt für Schritt, unter Schwierigkeiten, unter Widerständen, trotz allem der Demokratie nähert.“
….prodwigalis.“
Erzähler:
Jefgeni Proschtschetschin weiß, wovon er spricht. Seit Mitte der achtziger – damals noch als Dissident unter marginalisierten Bedingungen und elenden Lebensumständen – hat er sich dem Kampf gegen Faschismus und Extremismus in Russland verschrieben. Er gründete das „Antifaschistische Komitee Moskau“, für das er seit 1995 in die städtische Duma einzog, wo er die „Kommission zur Überwachung von Extremismus“ leitete. Mehr als eine Handvoll dickleibige Broschüren gab die Kommission in den Jahren von 1996 bis 1999 heraus, in denen sämtliche rechten und nationalistischen Gruppen aufgelistet wurden, die Ende der 80er und Anfang der neunziger wie Pilze aus dem Boden sprossen. Über 30 Gruppierungen zählt der erste Bericht von 1995 auf. Die größte davon war die militante „Russische nationale Einheit“, RNE des Alexander Barkaschow. Sie selbst gab ihre Mitgliederzahlen mit 100.000 an, Das Komitee schätzte sie auf 10.000. Zu den Dumawahlen 1999 wollte sich die RNE unter dem Namen „Spas“ Rettung sogar an den Wahlen beteiligen, was ihr in letzter Minute aus formalen Gründen untersagt wurde. Im letzten Bericht, den die Extremismus-Kommission 1999 herausbrachte, hatte sich die Zahl der Gruppen verdoppelt, was allerdings weniger auf zahlenmäßiges Wachstum, als auf steigende ideologische Tätigkeit und damit Differenzierung zwischen den Gruppen zurückzuführen war. Auch hatte das „Komitee“ sich gezwungen gesehen, der Kirche ein gesondertes Kapitel zu widmen. 1999 verlor Jewgeni Proschtschetschin sein Mandat in der Moskauer Duma. Seitdem hängen nicht nur die von ihm ausgearbeiteten Antifaschistischen Gesetze fest, es erschienen seitdem auch keine weiteren Berichte mehr über die Entwicklung der rechten Szene. Die Situation hat sich seit 1999, das heißt, seit dem Antreten von Wladimir Putin, entschieden geändert. Aber wie – das zu beschreiben, fällt Jewgeni Proschtschetschin schwer.
So kommt er zu der paradoxen Aussage:
A 9 – O-Ton: Proschtschetschin, Forts. 2.12..10
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Tut, otschen sloschni…
„Schwierige Frage: Einerseits hat sich überhaupt nichts geändert – außer der Auswechslung einiger Köpfe der Administration. Es ist so eine Stagnation, so eine Flaute, nicht wesentlich Neues. Es ist nichts von dem eingetreten, was befürchtet wurde, kein halber Faschismus, nein, nichts dergleichen. Spannungen gibt es natürlich, aber es ist alles langweiliger, flacher geworden, es gibt weniger politische Positionen. Die Duma hat sich in ein Organ verwandelt, das die Entscheidungen der Administration abstempelt. Die Presse wurde stromlinienförmig. Natürlich missfällt mir sehr die Wieder-Einführung der stalinschen, breschnewschen Hymne. Sehr missfallen hat mir das Getue rund um den verschlossenen Wagen des nord-koreanischen Diktators, für dessen Sonderzug man die Menschen vom Bahnhof gejagt hat. So etwas hat es noch nie gegeben. Weiter die große Anzahl der KGBler und FSBler, also von Geheimdienstlern im Regierungsapparat. Das ist alles sehr spannungsträchtig und unangenehm. Außerdem der endlose Krieg in Tschetschenien. Positiv ist allein, dass nach der Krise von 1998 die Menschen mehr einheimische Produkte kaufen. Die hohen Preise für Öl und Nickel geben uns eine Basis. Das macht die Hälfte des russischen Budgets aus. Darauf kann er soziale Probleme ein bisschen ausgleichen. Der Bevölkerung gefällt natürlich, dass der alte Jelzin weg ist; der war verbraucht. Der Neue ist jung, er kämpft, er ist für Ordnung, er greift hart durch. Deshalb herrscht jetzt diese politische Stille, dieser Stau. Was geschieht, wenn die Preise plötzlich fallen, das weiß niemand. Wir sind gegen nichts versichert! Der Stau Putins kann nicht ewig dauern, aber es gibt viele, denen das gefällt.“
… kamu to nrawitsja.“
Erzähler:
Unter diesen Umständen, so Jefgeni weiter, habe sich auch die extreme Rechte sehr verändert:
A 10 – O-Ton: Proschtschetschin, Fortsetzung 1.24.14
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Tosche apjat otschen…
„Das ist auch wieder erstaunlich: Praktisch – obwohl das schon mehr bei Jelzin geschehen ist als bei Putin – ist die mächtige neo-faschistische Bewegung RNE zusammengebrochen. In den letzten zwei, drei Jahren hört man von ihr fast nichts. Es gab eine Spaltung, an der ich nicht unbeteiligt war, natürlich indirekt. Wir initiierten damals eine Austrittsbewegung aus der RNE, eine Organisation von jugendlichen Barkaschowzis, ziemlich viele. Sie eröffneten ihren eigenen Sowjet, dann gaben sie eine eigene Zeitung heraus, traten in dem Medien auf usw. Es gab Konflikte, die Spaltung, 1998, und sie schlossen Barkaschow selbst aus. Er nannte seine Gruppe von da an, Gardia Barkaschowa, die Wache Barkaschows. Sie beschäftigten sich mit inneren Auseinandersetzungen. Nach der Wahl 1999 wurde es dann ganz still: Vor vier Jahren, war ganz Moskau mit Klebezetteln der RNE, 1999 auch noch mit denen der SPAS, überschwemmt, Barkaschowzis standen Wache, sie traten auf; jetzt gibt es praktisch keine. Das ist gut. Das ist die eine Seite.“
…odnoje stranje.“
Erzähler:
Auf der anderen Seite, so Jewgeni Proschtschetschin weiter, gebe es aber auch sehr belastende Symptome:
A 11 – O-Ton: Proschtschetschin, Forts. 40.23
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Nu, drogoi stranje jest…
„So wächst in letzter Zeit die Xenophobie, die Fremdenfeindlichkeit gewaltig an, und allen voran leider hier in unserem Moskau, in unserer Hauptstadt. Es wirken die Gesetze Bürgermeister Luschkows, diese idiotischen Registrationen und Kontrollen, gegen die ich seinerzeit gestimmt habe. Die teilen die Menschen auf in weiße und dunkle, unterscheiden sie nach der Nase. Das ist für eine zivilisierte Gesellschaft natürlich überhaupt nicht akzeptabel. So fängt man keinen Terroristen und ängstigt auch keinen Verbrecher. Das ist nur zusätzliches Taschengeld für die Miliz, die sich schmieren lässt, verlorenes Geld.“
…otrisannije dengi.“
Erzähler:
Schon unter Jelzin sei antifaschistische Arbeit kein Vergnügen gewesen, fährt Jewgeni Proschtschetschin fort; immerhin aber sei die Duma-Kommission, sei selbst das „Komitee“ zu Anhörungen gerufen worden. Jetzt aber habe sich das Blatt vollkommen gewendet:
A 12 – O-Ton: Proschtschetschin, Forts. 1.29.20
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Satrudnik organisatii…
„So berichtet ein Mitarbeiter unserer Organisation aus der Duma – wo er inkognito tätig ist – dass dort eine ganze Reihe von Abgeordneten die Fraktion der Schirinowski-Partei, ebenso wie die der kommunistischen Partei benutzen, um über deren Wege kostenlos Containerweise Literatur zu verteilen. Sie vertreiben sie über ganz Russland, wesentlich in Armeeabteilungen. Kürzlich ging eine riesige Sendung zu Truppen in Tadschikistan. Es handelt sich um antisemitische, nationalistische und faschistische Schriften, fragwürdige Literatur, natürlich Schriften des klassischen Faschismus vom Typ der so genannten „Protokolle der Weisen von Zion“, „Mein Kampf“ in russischer Sprache usw. Außerdem verkauft man sehr viele faschistische Lieder, Videokassetten, rassistische und faschistische Propagandafilme, auch künstlerischer Art wie „Jud süß“ – das alles wird praktisch ohne Einschränkung und straflos verteilt oder verkauft. Diesen Mist zu vertreiben ist leider profitabel geworden. Früher musste man das ohne Gewinn abgeben, heute nimmt diese Literatur einen ökonomischen Platz ein. Die Menschen bezahlen für dieses fragwürdige Vergnügen. Das ist eine sehr schlechte, beunruhigende Tendenz.
…triwolschnaja tendenzia.“
Erzähler:
Leider, so Jefgeni Proschtschtschin mit einem Seitenblick auf den patriotischen Auftritt der klerikalen Gruppe vor dem „Weißem Haus“ hätten sich auch in der Kirche die nationalistischen Tendenzen verstärkt:
A 13 – O-Ton: Kirche 1.50.22
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Nu, russkaja prawaslawnaja…
„Schon generell ist die russische orthodoxe Kirche Reformen sehr leider feindlich gesinnt: Ihre negative Haltung dem Papst gegenüber, ihre Feindschaft zu Kiew. Überdies genießen sie große Unterstützung von Seiten des Staates; unter Putin noch mehr als vorher. Das ist wieder diese Einheit von Staat und Kirche, anders als im Westen, wo Religion unabhängig ist. Und trotzdem hat man noch Angst vor Konkurrenz anderer Religionen, die man mit allen Mitteln zu übervorteilen trachtet. So entstehen große Widersprüche zwischen dem Anspruch der Kirche auf Heiligkeit und ihrer Unterstützung durch Geld, Polizei, den Apparat. Der Klerus macht dunkle Geschäfte mit Alkohol und Tabak. Die Leute geben Geld für gute Zwecke, aber keiner weiß wohin es geht. Auch innerhalb der Kirche gibt keine Reformen: Die Kirchensprache ist immer noch Altslawisch, was praktisch niemand versteht. – Das alles schafft keine Autorität; das schafft keinen neuen Glauben – es bleibt ein ideologisches Vakuum. Deshalb kann jede beliebige extremistische Ideologie diesen Platz ausfüllen. Die Ideologie hat sich nach dem Ende der Sowjetunion ja keineswegs gleich der Orthodoxie zugewandt. Keineswegs! Die Menschen wissen nichts davon! Viele haben ihre eigenen Vorstellungen, glauben an Zauberer und Hexen, Das ist extrem gefährlich, weil extreme, marginale Ideologien äußerst schnell und sehr massenhafte Verbreitung finden können, extrem gefährlich.“
…krainje apasna.“
Erzähler:
Zwei Linien lassen sich, so Jefgeni Proschtschtschin, vor dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in der Rechten beobachten: Die eine zeige sich in den Skins, die neuerdings durch Moskau und andere Städte marodierten. Sie nehmen die fremdenfeindlichen Parolen Juri Luschkows, Wladimir Putins, des tschetschenischen Krieges und einzelner Gouverneure zum Anlass, über nicht-russische Minderheiten herzufallen. Von der Miliz werden sie als „Fußballfans“ heruntergespielt. Passanten berichten nach solchen Überfällen aber immer wieder, dass sie Abzeichen der RNE auf den Kutten dieser Fans gesehen haben. Bei einem der letzten Vorfälle dieser Art überfiel eine Horde von ca. 300 solcher „Fans“ mit Knüppeln und Schlageisen bewaffnet drei Vorortmärkte systematisch nacheinander, wo sie auf die vornehmlich kaukasischen Händler einprügelten. Ergebnis: Zwei Tote und über zwanzig Verletzte. Bei den Überfällen am 20. April wurde ein Tschetschene erstochen.
Die Sprüche, bald werde ganz Russland unter der Herrschaft der Skins stehen, verweist Jefgeni Proschtschtschin ins Reich kranker Gehirne. Für offenen Terror und für offene faschistische Sprüche sei die russische Bevölkerung nach ihren Erfahrungen mit Stalin und Hitler nicht zu haben. Die Gefahr eines neuerlichen Umsturzes will der Chef des Moskauer antifaschistischen Komitees jedoch nicht ausschließen:
A 14 – Ton: Jefgeni. Forts. 52.19
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Jesli, tak skaschim, formje..
„In der Form der Barkaschowzis – natürlich nicht. Aber von Seiten der Gesellschaft, auf Grundlage der Xenophobie, da besteht schon so eine Gefahr. Sie wird kaum die offene Form á la Barkaschow annehmen. Das war ja auch in Deutschland anfangs so, aber dann gab es die Nürnberger Gesetze, dann das, dann das und so ging es Schritt für Schritt in Richtung des Genozids. Im russischen Staat ist prinzipiell alles möglich. Ich würde mich da nicht festlegen wollen. In all den Aspekten der Wirtschaft, der sozialen Probleme, den Arbeitsverhältnissen, in allen Fragen des Extremismus herrscht eben Ruhe vor dem Sturm.“
…tische pjered burje.“
Erzähler:
Die eigentliche Gefahr, so Jefgeni Proschtschtschin weiter, gehe ja nicht von den Militanten, sondern von der anderen Linie aus, von den neuen Rechten, die sich inzwischen ins Establishment integriert hätten, wo sie als ideologischer Impulsgeber der neo-imperialen Renaissance Russlands wirkten. Als exemplarisch dafür nennt er die Karriere Alexander Dugins. Dugin, seinem Selbstverständnis nach „Geopolitiker“, der Russlands Mission darin sieht, Euroasien unter russischer Führung zu vereinen, um die Vorherrschaft der USA zu brechen, galt zu Zeiten der Perestroika als national-bolschewistischer Extremist. Nur ein halbes Jahr nach Antritt Präsident Putins gründete er mit offizieller Unterstützung eine „Euroasiatische Bewegung“. Alexander Dugins aktuelle Rolle skizziert Jefgeni Proschtschtschin mit den Worten:
A 15 – O-Ton: Jefgeni Proschtschtschin, Forts. 1.30.26
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Nu, ja dumaju…
„Nun ich denke, dass die Lage Dugins ziemlich stabil ist, ziemlich gut für ihn, er ist faktisch zum Teil des Establishments geworden. Kürzlich hat er in der Stadt Rostow seinen Doktor gemacht, es gibt da auch noch einen Boris Reschwik, mit dem er zusammenarbeitet, ein Typ mit rein faschistischer Haltung. Gleichzeitig war er wichtigster Ratgeber für Selesnjow, den Duma-Präsidenten der Kommunistischen Partei. In der Beliebtheitsskala russischer Internetseiten steht Dugin auf dem vierten Platz. Dugin ist also ein Mensch, der stark auf die Gesellschaft einwirkt. Und dass man einen Menschen, der Himmlers SS für eine humanitäre Organisation hält, derart akzeptiert, dass er bei dem Duma-Präsidenten Selesjnow arbeiten kann, dass er einer der Ideologen der „Bewegung Russland“ gewesen ist, , dass man ihn oft ins Fernsehen einlädt, das heißt nur, dass das allgemeine Niveau von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit soweit angewachsen ist, dass für einen solchen Menschen Nachfrage besteht. Was noch vor zehn Jahren peinlich war auszusprechen, das wird jetzt als wissenschaftliches Modell akzeptiert, das ist sehr schlecht.“
… otschen plocha.“
Erzähler:
Im Büro der neu gegründeten „Euroasiatischen Bewegung“ wird sofort klar, was Antifaschisten und Demokraten beunruhigt. Alexander Dugin empfängt nicht mehr, wie noch vor der Wahl Wladimir Putins im Hinterzimmer eines dubiosen Plattenladens, sondern in einem funkelnagelneuen, computerisierten und nach neuestem Chic durchgestylten Appartement in einem teuren Geschäftshaus. Beim Treffen lässt er sich dieses mal damit entschuldigen, dass er überraschend zu einem Termin ins Ministerium berufen worden sei. Statt seiner empfangen zwei junge Burschen den ausländischen Besucher. Einer stellt sich als Chef der neu gegründeten Zeitung „Euroasien“, der andere als „Koordinator der Bewegung“ vor. Alexander Dugins Chefredakteur war zuvor Chef vom Dienst bei Alexander Prochanow, dem Herausgeber der bekanntesten national-bolschewistischen Zeitung Russlands, „Sawtra“, morgen, bei dem auch Alexander Dugin lange Zeit schrieb. Unter dem Namen „Djen“, der Tag, stand sie 1993 in vorderster Reihe des Widerstandes, den Boris Jelzin mit Panzern im „Weißen Haus“ zusammenschießen ließ. Jetzt hat der junge Mann vom, wie er sagt „ewiggestrigen Prochanow“ zum „modernen Dugin“ gewechselt, weil der über ein Konzept verfüge, das in der Lage sei, die Gesellschaft tatsächlich zu verändern.
Am weißen Konferenztisch ihres Empfangssaales erläutern die beiden Aktivisten die Erfolge ihrer Bewegung:
A 16 – O-Ton: im Büro der „Euroasiatischen Bewegung“ 1.30.24
Regie: O-Ton kurz frei stehen lassen, abblenden, unterlegen, wieder hochziehen
Übersetzer:
„Dweschennije prosta rastjot…
„Die Bewegung wächst einfach wie auf einer Versteigerung, ständig neue Gruppen, ständig neue Leute aus der intellektuellen Elite. Ein halbes Jahr nach der Gründung haben wir schon in allen Regionen Gruppen. Zweitens wachsen die Initiativen. Da war zunächst der Kongress “Drohung des Islam oder Islam in der Bedrohung?“, der großes öffentliches Interesse fand – in der Presse, im TV, im Internet. Es gab ernsthafte Beratungen mit der Administration.“
Regie: Vorübergehend hochziehen
Erzähler:
„Die islamische Konferenz“, ergänzt der andere junge Mann, haben wir noch aus eigenen Kräften organisiert. Inzwischen gibt es über zehn Vorschläge für weitere Konferenzen zu anderen Themen aus den Regionen. Initiatoren sind schon nicht mehr wir, sondern örtliche Initiativen und Administrationen. Wir werden nur noch um Teilnahme und konzeptionelle Gestaltung gebeten, also dass Alexander Dugin oder Leute seines Vertrauens dort Vorträge halten. Das letzte Beispiel ist eine Konferenz, die wir mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche planen. Es geht um die Rolle, die die russisch-orthodoxe Kirche für Russland spielen muss. Das ist auch für den Präsidenten von großer Bedeutung.“
… president.“
Erzähler:
Ein Blick auf den Trägerkreis der Islam-Konferenz macht klar, wie weit Alexander Dugin und seine Leute es bereits gebracht haben: Da stehen die Administration des Präsidenten, die Staatsduma und die Zentrale geistliche Führung des Islam in Russland einträchtig untereinander; als Mitglieder des Organisationskomitees lässt sich neben dem Vorsitzenden der Duma, Selesnjow; neben dem obersten Mufti der russischen Muslims, Scheich ul islam Talgat Tadschuddin und anderen auch der Metropolit der Moskauer orthodoxen Kirche, Kyrill nennen. Wladimir Putin wird als Schutzpatron der Konferenz mit Aussagen zur euroasiatischen Orientierung seiner Politik zitiert. Als Ergebnis präsentierte die Konferenz einen Plan zur Teilung Tschetscheniens, welcher der Administration empfohlen wird. In ihm ist die dort lebende Bevölkerung nur noch imperiale Verschiebemasse.
Letzte Höhepunkte in der Karriere Alexander Dugins sind die Erklärungen, mit denen er sich in Russland und per Internet in die Auseinandersetzung zur Globalisierung einmischt. Er stimmt ihren Kritikern zu und fordert sie auf, sich gemeinsam mit ihm und der „Euroasiatischen Bewegung“ gegen die Führungs-Ansprüche der USA und für eine neue multipolare Welt einzusetzen.
Möglich ist dies vor dem Hintergrund, dass die russische Bevölkerung in den letzten Jahren tatsächlich Opfer neo-liberaler Experimente wurde, dass Russland sich tatsächlich zwischen Asien und Europa definiert, dass Wladimir Putin, anders als zuvor Michail Gorbatschow und auch noch Boris Jelzin, tatsächlich eine Politik zwischen Asien und Europa zu entwickeln versucht. Unter Ausnutzung dieser Tatsachen hat Alexander Dugins Propaganda alle Aussichten, zu einem ideologischen Treibsatz zu werden, in dem der nationalistische Explosivstoff in der berechtigten Kritik an der Globalisierung und dem friedlichen Eintreten für eine gerechtere neue Weltordnung versteckt wird.
Ulaanbaator: Beobachtungen am Rande der zivilisierten Welt…
Russland im Sommer 2002
Stationen einer Reise
Ulaanbaator ist eine Reise wert. Das gilt insbesondere, wenn sich Mongolisten aus aller Welt dort treffen, um zu beraten, wie es mit der Modernisierung des Nomadentums weitergehen kann und welche Beziehung das nomadische Leben zukünftig neben oder im Prozess der Globalisierung der Zivilisation, sprich der Welt des industriellen Fortschritts einnehmen kann oder soll. In dieser Frage ist man, wie aus den Beiträgen und Gesprächen der über 400 Gäste des Kongresses hervorgeht, keineswegs einer Meinung. Die einen zitieren den englischen Staatstheoretiker Thoynbee, der dem Nomadentum zwar eine hohe Bedeutung für die Geschichte der Menschheit beimisst, der aber schon für das letzte Jahrhundert die Zeit gekommen sah, da nomadische Kultur generell in die moderne Zivilisation aufgehen werde.
Kurz gesagt: Die Zeit des Nomadisierens sei vorbei, so Thoynbee; was noch an nomadischen Kulturen existierte, allen voran die zentralasiatischen, im Besonderen die mongolische, betrachtete er als auslaufendes Modell, das der entstehenden städtisch-industriellen Zivilisation weichen müsse.
Töne a la Thoynbee hört man heute keineswegs nur von den Gästen aus dem Westen, aus Russland oder aus den Reihen der zahlreichen chinesischen Delegation. Auch von mongolischen Wissenschaftlern werden solche Positionen vertreten: Die Mongolei, fordern sie, müsse die nomadische Art der Viehwirtschaft durch systematisches Ranching ablösen, wenn sie auf dem globalen Markt bestehen und nicht zwischen den großen Nachbarn China und Russland als Rohstoff- oder Land-Reservoir verbraucht werden wolle.
Eine Modernisierung dieser Art entspräche im Übrigen auch den Vorgaben des IWF, der Weltbank und verschiedner Entwicklungsbanken, die über die Mongolei dasselbe Raster einer „effektiven Reformpolitik“ legen wie sie es über Russland oder irgendein anderes „Entwicklungsland“ gelegt haben – ungeachtet der Tatsache, ob die zugrundegelegten Erfolgsraster auf das jeweilige Land anwnedbar sind oder nicht. Mag man das in Russland noch für strittig halten – hier in der Mongolei ist offensichtlich, daß nicht nur nach-sowjetische, sondern insbesondere die bedingungen des nomadischen Lebens absolut nicht die Vorgaben des IWF erfüllen. „Aber“, so versuchte eine Teilnehmerin des Kongresses aus Holland die Politik des IWF zu erklären, „was ökonomisch effektiv ist, muß nicht immer sozial richtig sein.“ Unklar blieb, ob das als Kritik oder als Rechtfertigung des IWF zu verstehen sei.
Diesen Vertretern einer schroffen Modernisierung stehen naturgemäß ebenso schroffe Traditionalisten gegenüber, die nomadisches Leben, nachdem es durch die sowjetische Modernisierung und Zwangs-Urbanisierung bereits von 80% auf 30% der Bevölkerung reduziert war, heute in seiner ursprünglichen Reinheit wiederherstellen wollen. Dabei stellt sich natürlich sofort die Frage, wo die ursprüngliche Reinheit beginnt. Einige Mongolen gehen bis zu den Hunnen zurück. Andere belassen es bei den von Tschingis Chan überlieferten Regeln. Hier trifft sich ethnischer Traditionalismus mit einem neuen nationalen mongolischen Selbstbewusstsein: Ein ganzer Tag des siebentägigen Kongresses war dem offiziellen Gedenken an den 840 Geburtstag Chingis Chans gewidmet. Staatspräsident Nazagiln Bagabandi höchst persönlich und eine ganze Reihe weiterer Persönlichkeiten der Mongolei hielten an diesem Tag lange Reden zu Ehren des archaischen Reichsgründers, der neben der nomadischen Kultur das zweite identitätsstiftende Element für die heutige Mongolei abgibt.
Vertreter traditionalistischer Positionen sind nicht selten schon an ihrer Kleidung zu erkennen. In prächtigen Fest-Dels, den praktischen Umhängemänteln der Nomaden, in malerischen Spitzhüten und Stiefeln beleben sie – unter ihnen nicht wenige westliche Wahlnomaden – die ansonsten eher europäisch-konservative Kleiderordnung des Kongresses.
Seriöse Positionen, will sagen, zukunftsfähige Positionen, liegen zwischen diesen Polen. Die Mehrheit der Teilnehmer/innen des Kongresses ist auf dieser mittleren Linie zu finden: Etwas Drittes müsse entstehen, heißt es, einfach deshalb, weil es nicht anders gehe, weil die natürlichen Bedingungen keine Landwirtschaft des Siedlungstyps zuließen,
weil die nomadische Kultur für die mongolische Bevölkerung lebenserhaltend sei, weil die Mongolei zwischen den Siedler-Imperien China und Russland gar keine andere Wahl habe, als seine Andersartigkeit zu erhalten, wenn es nicht untergehen wolle, weil die Mongolei nicht an die Spitze der Globalisierung spurten könne, aber auch nicht in die Steinzeit zurückfallen dürfe.
Bleibt die Frage: Wie?
Nach zehn Jahren Schock-Privatisierung zeigen sich in der Mongolei ähnliche Phänomene wie in Russland: Aus dem Überschwang einer übertriebenen Privatisierung, die zu erheblichen sozialen Ungleichgewichten geführt, vor allem den Besitz an Tieren so ungleich verteilt hat, daß eine geregelte Beweidung der nicht-privatisierten und nach allgemeiner Übereinstimmung auch nicht privatisierbaren Steppen nicht möglich ist, setzt jetzt eine Etappe der Rückbesinnung auf kollektive Formen der Bewirtschaftung ein. Ansätze von Kooperativen bilden sich, in denen sich drei, vier oder fünf Hirten-Familien zusammentun, um die Steppen gemeinsam zu beweiden und die Weiterverarbeitung der tierischen Produkte und deren Verkauf sowie die Anschaffung der dafür notwendigen neuen Technik, Infrastruktur und sogar Ausbildung gemeinsam zu organisieren. Diese Entwicklung beginnt erst. Hier liegt die Perspektive einer Modernisierung des nomadischen Lebens ohne Liquidierung der nomadischen Kultur.
Ulaanbaator 7.8.2002
www.kai-ehlers.de
Autorennamen bitte so angeben
Kai Ehlers. Publizist,
www.kai-ehlers.de, info@kai-ehlers.de
D- 22147 Rummelsburgerstr. 78,
Tel./Fax: 040/64789791, Mobiltel: 0170/2732482
© Kai Ehlers, Abdruck gegen Honorar,
Kto: 1230/455980, BlZ: 20050550

Themenheft 7: Altai
THEMENHEFT 7:
Altai
Texte und Features rund um eine vergessene Region
Januar 1998
Mongolei – Heimat der letzten Indianer oder Chance zur Modernisierung? S.1
Mai 1998
Das andere Russland:
Eine Reise hinter den mongolischen Vorhang S. 13
November 2000
China – Russland:
Stille Invasion oder strategische Partnerschaft? S. 27
Januar 2001
Altai – Wiege der Völker und letzte Zuflucht? S. 40
Februar/November 2001
Globalisierung und Identität S. 53
Zur Person: Der Autor S.54